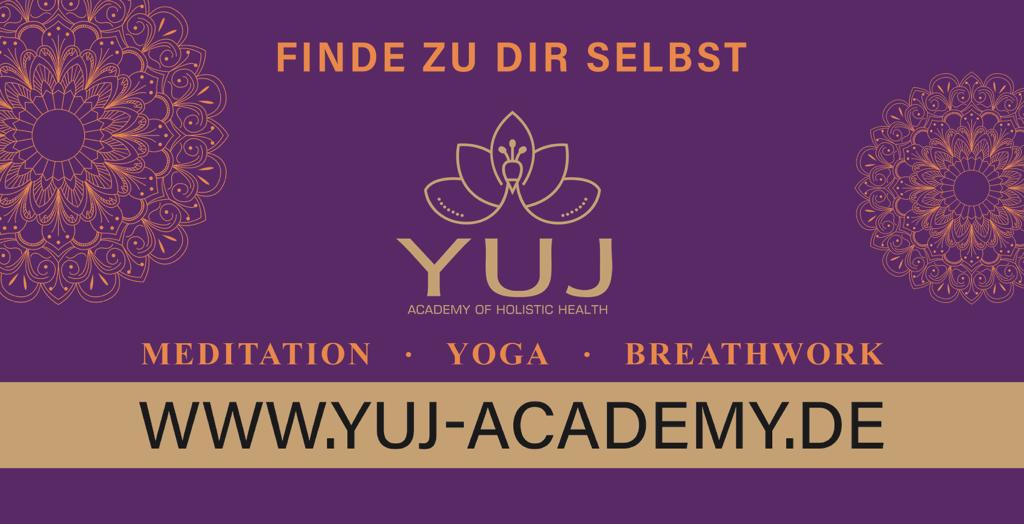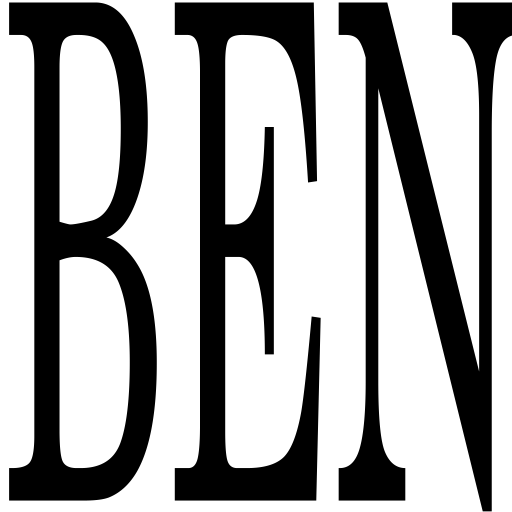Gesundheit
Stiftung Scheuern lässt 24 neue Rehaplätze in Nassau entstehen
 Foto von links: Judith Bechstedt (Fachbereichsleiterin Wohnen und INTEGRA), Friedhelm Gödert (verantwortlicher Architekt), Bernd Feix (Pädagogischer Vorstand der Stiftung Scheuerrn), Sonja Behnke (Pädagogische Projektleiterin) und Anne Ziegert (Teamleiterin der Rehagruppe).
Foto von links: Judith Bechstedt (Fachbereichsleiterin Wohnen und INTEGRA), Friedhelm Gödert (verantwortlicher Architekt), Bernd Feix (Pädagogischer Vorstand der Stiftung Scheuerrn), Sonja Behnke (Pädagogische Projektleiterin) und Anne Ziegert (Teamleiterin der Rehagruppe).
NASSAU Hell, freundlich und vor allem sehr großzügig: Dass die künftigen Räumlichkeiten der INTEGRA-Rehagruppe der Stiftung Scheuern ein großer Zugewinn sind, ist kaum zu übersehen.
Das heißt, eigentlich sind es zwei Gruppen, die hier in einigen Monaten ihr neues Quartier beziehen werden: Bisher bietet INTEGRA für Menschen mit erworbener Hirnschädigung eine Rehagruppe im Haus Bodelschwingh am Hauptsitz der Stiftung Scheuern in Nassau und eine weitere im Elmar-Cappi-Haus in Bad Ems an. Beide werden nun am neuen Standort im ehemaligen Schwesternwohnheim des Marienkrankenhauses im Neuzebachweg 4 in Nassau zusammengeführt.
 Anzeige
Anzeige Noch sind im Erdgeschoss des Gebäudes, in dessen beiden oberen Stockwerken bereits von der Stiftung Scheuern betreute Menschen mit geistiger Behinderung wohnen, allerdings die Umbauarbeiten in vollem Gange – um den Stand der Dinge ging es jüngst bei einer Baustellenbegehung, bei der die pädagogische Projektleiterin Sonja Behnke und der bauleitende Architekt, Friedhelm Gödert vom Planungsbüro CLP in Koblenz, den pädagogischen Vorstand der Stiftung Scheuern, Bernd Feix, die Fachbereichsleiterin Wohnen und INTEGRA, Judith Bechstedt, und die Teamleiterin Rehagruppe, Anne Ziegert, informierten.
Wobei es bereits außerhalb des Gebäudes einige Veränderungen geben wird: Der bisherige Parkplatz wird in einen Wendehammer für Busse, beispielsweise des von der Stiftung Scheuern beauftragten Beförderungsunternehmens, und Lkws umgewandelt – das zurzeit noch erforderliche Hinein- und Rückwärts-wieder-Hinausfahren entfällt damit. Als Ersatz für die Stellplätze, die dem Wendehammer zum Opfer fallen, werden auf einem oberhalb gelegenen Plateau Ausgleichsparkplätze entstehen. Und: Es ist ein barrierefreier Weg geplant, der von der Ausstiegsstelle, die das Beförderungsunternehmen anfährt, zum unterhalb des Wendehammers gelegenen Haupteingang der neuen Rehagruppe führt. Dieser soll zudem einen gepflasterten Vorplatz bekommen. Wo genau der Zugangsweg verlaufen wird, steht noch nicht fest. „Um die sinnvollste Lösung zu finden, haben wir einen Vermesser damit beauftragt, das Gelände aufzunehmen“, berichtete Friedhelm Gödert.
Und drinnen im Gebäude mit seinen insgesamt vier Bereichen? Obwohl zum Zeitpunkt der Baustellenbegehung kurz nach Beginn der Arbeiten im Wesentlichen erst die Rückbauarbeiten erledigt waren, konnte man sich zumindest grob schon vorstellen, wie es in Kürze dort aussehen wird. In Bereich 1 entstehen eine Wohnküche, ein großer Gemeinschaftsbereich für gemeinsame Aktivitäten sowie ein offener und ein durch eine Tür abgetrennter geschlossener Ruhebereich. Im gegenüberliegenden Bereich 4 werden das Büro und mehrere barrierefreie Sanitärräume angesiedelt sein.
Bereich 2 rund um die ehemalige Sakristei, die noch eine neue Verglasung bekommt, beherbergt neben einer weiteren Küche eine Multifunktionsfläche und zwei Therapieräume, unter anderem für neurophysiologische Behandlungen. Von diesem Bereich aus hat man zudem Zugang zum Park. In Bereich 3 wird man künftig die arbeitspädagogischen Räume sowie die Seifen- und die Holzwerkstatt finden. „Um die Klientinnen und Klienten stärker als bisher auf die berufliche Wiedereingliederung vorzubereiten, wird der arbeitspädagogische Bereich der Rehagruppe deutlich ausgebaut“, betonte Sonja Behnke. Aber nicht nur der: Statt wie bisher insgesamt 17 wird die neue Rehagruppe 24 Vollzeitplätze für Menschen mit erworbener Hirnschädigung bieten, die je nach Bedarf und Nachfrage in Teilzeitplätze aufgegliedert werden können. „Für Menschen, die uns kennenlernen möchten, ist auch ein stundenweiser Besuch der Rehagruppe möglich“, ergänzte Sonja Behnke. Voraussichtlich zehn bis zwölf Mitarbeitende werden dort tätig sein.
 Anzeige
Anzeige Wo wird das Pflaster des Innenhofs und der Terrasse angehoben, um einen barrierefreien Zugang zu schaffen? Warum muss in diesem Raum hier die Bodenplatte herausgenommen werden? Und was geschieht mit der Leinwand, die momentan noch dort hängt, wo demnächst eine Küche entsteht? Um diese und viele weitere Details ging es bei der Baustellenbesprechung. Insgesamt sind für den Umbau rund 545 000 Euro veranschlagt. Die Aktion Mensch fördert die Maßnahme dankenswerterweise mit 110 000 Euro. Zur Erklärung: Als größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland unterstützt die Aktion Mensch Projekte, die die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen verbessern. Mitte November, spätestens aber am 1. Dezember wird es dann so weit sein und die neue Rehagruppe an den Start gehen. „Unsere Klientinnen und Klienten freuen sich schon sehr darauf“, berichtete Sonja Behnke.
INTEGRA – was ist das eigentlich?
INTEGRA, eine Dienstleistung der Stiftung Scheuern, leistet zielgruppenspezifische und bedarfsgerechte Wohn-, Arbeits-, Beratungs-, Selbsthilfe und Teilhabeangebote für Menschen mit erworbener Hirnschädigung. Zum Konzept gehört auch das spezialisierte Tagesförderstätten-Angebot Rehagruppe. Deren Assistenzleistungen umfassen unter anderem das gemeinsame Erarbeiten einer sinnvollen Tagesstruktur, die Unterstützung bei der Wiedererlangung dem Erhalt von Fertigkeiten und psychosozialen Kompetenzen, individuelle Beschäftigungsangebote und die Vorbereitung auf Leistungen für die Teilhabe am Arbeitsleben.
 Anzeige
Anzeige Gesundheit
Stille Stunde: Einkaufen für Menschen mit Autismus etc. in den CAP-Märkten

RHEIN-LAHN/WW Ein bedeutender Schritt für Menschen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen startet Mitte Juni: 97 CAP-Märkte in ganz Deutschland führen die „Stille Stunde“ ein. Dieses innovative und inklusive Konzept zielt darauf ab, reizarme Einkaufsbedingungen zu schaffen und somit das Einkaufserlebnis für Betroffene angenehmer zu gestalten.
In den CAP-Filialen besetzen Menschen mit Behinderung bis zu 50 % der Arbeitsplätze. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen verantwortungsvolle und qualitativ hochwertige Aufgaben, die genau auf ihre individuellen Fähigkeiten abgestimmt sind. Für Kunden und Kollegen bedeutet dies vor allem eines: Normalität im Alltag. „Die Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung – ganz gleich ob sichtbar oder nicht – zu fördern, zur Sensibilisierung beitragen und somit Teilhabe zu ermöglichen, ist für uns so wichtig wie selbstverständlich“, erklärt Thomas Heckmann, Vorstand der GDW Süd.
Die „Stille Stunde“ wurde ursprünglich von Theo Hogg, einem Angestellten eines neuseeländischen Supermarkts mit autistischen Kind, entwickelt und hat sich bereits in Ländern wie der Schweiz, USA und Großbritannien etabliert. Während dieser Stunde werden laute Musik, Durchsagen und grelles Licht reduziert, um die Reize für betroffene Menschen zu minimieren.
Unterstützt wird die Kampagne vom Verein „gemeinsam zusammen e.V.“ und der Plattform www.stille-stunde.com. Die Plattform bietet Betroffenen, Coaches und Unternehmen die Möglichkeit, sich zu informieren und sich für die Teilnahme zu registrieren. Hinter dem Projekt steht ein deutschlandweites Konzept, das Menschen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen vernetzen, sichtbar machen und fördern möchte. Der Verein unterstützt dabei deutschlandweit den Handel und darüber hinaus viele Kommunen in der Prozessgestaltung und bietet vielseitige Unterstützung in Form von Konzepten, Marketing und Beratung an.
Das Leid der betroffenen Menschen ist gesellschaftlich noch oft unbekannt. Isolation und Rückzug, aber auch Zusammenbrüche und Eigen- sowie Fremdgefährdung können im schlimmsten Fall die Folge sein. Die „Stille Stunde“ in den CAP-Märkten hat das Potenzial, das Einkaufserlebnis für viele Menschen angenehmer zu gestalten und das Bewusstsein für die Bedürfnisse von Betroffenen zu stärken.
Das Ziel des Vereins ist, Maßnahmen zur Inklusion neu zu lehren, sodass neben mobilen und taktilen Barrieren in Zukunft auch immer sensorische Barrieren mitgedacht und einbezogen werden. Es ist wichtig, diesen betroffenen Menschen eine Stimme zu geben und Aufklärung zu leisten.
„Wir sind begeistert und spüren, dass das Thema inzwischen immer mehr als inklusive Maßnahme anerkannt wird. Die CAP-Märkte leisten mit dieser strukturellen Einführung großartige Pionierarbeit und sind ein wichtiger Partner bei unserem Bestreben, den Menschen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen eine Stimme zu geben“, erklärt Angelina Bergmann, selbst Mutter eines autistischen Kindes, vom Kernteam des Vereins “gemeinsam zusammen e.V.”
Nicht sichtbare Beeinträchtigungen:
Autismus-Spektrum, ADHS, Tourette, Hochsensibilität, Epilepsie, ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome), MS (Multiple Sklerose), Post-COVID, Depression, Demenz, Postvaccine, Schmerzpatienten, Herzerkrankung, Suchterkrankung, Balbuties (Stottern), Lupus, FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders), PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung), Hashimoto, Endometriose, Fibromyalgie, Migräne, Essstörungen, Hydrocephalus, Schwerhörigkeit, Krebs, MCAS (Mastzellenaktivierungssyndrom), Reizdarmsyndrom, Restless-Legs-Syndrom, ALS (Amyotrophe Lateralsklerose), Borreliose, Darmerkrankungen, Chronische Gastritis, Histaminintoleranz und viele mehr.
Patienten mit diesen Diagnosen haben auf die Kampagne der “Stillen Stunde” reagiert. Sie leiden an der Reizüberflutung und der sozialen Herausforderungen durch Symptome, Nebenwirkungen oder durch die Beeinträchtigung an sich.
Gesundheit
Leitender plastischer Chirurg aus dem St. Elisabeth Krankenhaus eröffnet eigene Praxis in Lahnstein

LAHNSTEIN Der ehemalige Leiter der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie des bis auf die Psychiatrie geschlossenen St. Elisabeth Krankenhauses in Lahnstein, Dr. Viktor Molnar, hat eine eigene Praxis eröffnet. Der 42-jährige übernahm Praxisräume in derAdolfstraße 36 in Lahnstein und baute sie zu einer Privatpraxis für Plastische und Ästhetische Chirurgie sowie Handchirurgie um. Der Lahnsteiner Oberbürgermeister Lennart Siefert überbrachte zur offiziellen Praxiseröffnungsfeier am 7. Juni 2024 die Glückwünsche der Stadt und wünschte viel Erfolg.
„Durch die Schließung der örtlichen Chirurgie ist eine Versorgungslücke entstanden. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, diese zu schließen. Weil ich mich mit der Region stark verbunden fühle, ist es mir zudem persönlich wichtig, in Lahnstein zu bleiben und hier eine Praxis zu eröffnen“, sagt Molnar. Seit Mitte Mai bietet er das komplette Spektrum der ästhetischen und plastischen Chirurgie sowie Handchirurgie an, von der Behandlung von Hauttumoren bis hin zu ästhetischen Operationen. Mit der bisherigen Entwicklung der Praxis zeigt er sich zufrieden, viele Patienten aus dem St. Elisabeth Krankenhaus hätten auf die Eröffnung gewartet und seien inzwischen wieder bei ihm.
In der Praxis sind in mehreren Behandlungsräumen operative und nichtoperative Therapien möglich. Für größere Operationen unter Narkose greift er auf Operationssäle im AOZ im Ev. Stift St. Martin in Koblenz zurück. Dr. Molnar wird in der Praxis durch seine Ehefrau Eszter Molnar-Zoltai, die als Praxisassistentin tätig ist, sowie durch die medizinische Fachangestellte Frau Helena Linder unterstützt, mit der er schon am St. Elisabeth Krankenhaus zusammengearbeitet hatte.
Bei der Feierstunde zur Praxiseröffnung dankte Molnar auch den vielen Handwerkern, Arztkollegen und Freunden, die ihn in den letzten Monaten auf dem Weg in die Selbstständigkeit unterstützt hatten. Diese große Hilfe von allen Seiten sei keine Selbstverständlichkeit. Sie habe ihn in seinem Entschluss, in Lahnstein zu bleiben, bestärkt.
Dr. Viktor Molnar hat Medizin in Tübingen studiert und dort auch promoviert. Er ist Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und verfügt über eine Zusatzbezeichnung für Handchirurgie. Nach Stationen in großen Krankenhäusern in Stuttgart, Offenbach und Koblenz war er ab 2017 ärztlicher Leiter von Koblenz Aesthetics und Sektionsleiter der Plastischen und Handchirurgie am St. Elisabeth Krankenhaus in Lahnstein. Er ist ordentliches Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (DGPRÄC), der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie (DGH) und der American Society of Plastic Surgeons. Molnar ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und zwei Söhnen in Lahnstein.
Gesundheit
Ambulante Versorgung auf Rädern: Mobile Arztpraxen bald unterwegs

RHEIN-LAHN Ein neues innovatives Instrument im Portfolio der Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) sind zwei Mobile Arztpraxen: die rollenden Arztpraxen für Rheinland-Pfalz gehen voraussichtlich in der kommenden Woche an den Start. Hintergrund sind immer wieder ad hoc schließende Praxen und damit Patientinnen und Patienten, die ohne hausärztliche Versorgung dastehen. In entsprechenden Regionen kommen die Mobilen Arztpraxen zum Einsatz. Unterstützt wird das Projekt vom Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz (MWG) mit jeweils 50 Prozent der Investitionskosten der beiden Fahrzeuge.
Aufgrund des Ärztemangels und des demografischen Wandels kommt es zu immer mehr Praxisschließungen ohne Nachfolge, was eine höhere Anzahl an Versorgungsengpässen mit sich bringt. Bereits heute sind über 300 Hausarztsitze unbesetzt und fehlen in der Versorgung. Um kurzfristig entstehende Versorgungsengpässe aufzufangen, hat die KV RLP in Kooperation mit dem MWG Mobile Arztpraxen entwickelt. „Bei der Mobilen Arztpraxis handelt es sich um ein wie eine Hausarztpraxis ausgestattetes Fahrzeug, das von uns betrieben wird und mit einer Ärztin bzw. einem Arzt sowie einer Person mit medizinischer Ausbildung besetzt ist“, erklärt der Vorsitzende des Vorstands der KV RLP, Dr. Peter Heinz.
Patientinnen und Patienten, für die die Mobile Arztpraxis bereitsteht, gehen genauso vor, wie bei einem Arztbesuch in der Praxis: Termin vereinbaren, Versichertenkarte einpacken und vor Ort behandelt werden. Das Angebot ist für alle da – Erwachsene, Kinder und Jugendliche, unabhängig von der Krankenkasse. In der Mobilen Arztpraxis werden alle gesundheitlichen Beschwerden behandelt, mit denen Patientinnen und Patienten auch zu ihrer Hausarztpraxis gehen würden. Auch das Ausstellen von Rezepten und einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) ist möglich.
Flexibles, am Bedarf orientiertes Angebot
Ziel ist die Sicherstellung der ambulanten Patientenversorgung in Bereichen, in denen kurzfristig ein Versorgungsengpass entsteht. Die zwei Mobilen Arztpraxen sind keine Dauerlösung, sondern überbrücken den Zeitraum, bis die Patientinnen und Patienten eine neue Hausarztpraxis gefunden haben. Die Einsatzdauer hängt vom Ausmaß der Versorgungsengpässe im Bundesland ab und beträgt mindestens einen Tag, sollte aber insgesamt drei Monate nicht überschreiten. Die genauen Sprechzeiten werden individuell festgelegt.
Ambulante Versorgung stärken und Arztpraxen entlasten
„Viele niedergelassene Medizinerinnen und Mediziner stellen fest, dass die Suche nach einer Nachfolge zunehmend schwieriger wird. Die Belastung für die Arztpraxen in der näheren Umgebung steigt entsprechend. Um diese Zeit zu überbrücken, bis eine Nachfolge gefunden ist, kann der Einsatz der Mobilen Arztpraxis erfolgen. Dies gibt den Menschen vor Ort Sicherheit, dass die medizinische Versorgung und wohnortnahe Behandlung – wenn auch in anderer Form als gewohnt – weiterhin vor Ort sichergestellt bleibt. Die Mobile Arztpraxis kommt daher an festgelegten Terminen zu festgelegten Orten, beides mit der Kommune abgestimmt“, erläutert Gesundheitsminister Clemens Hoch. Um die bestehenden Probleme nachhaltig anzugehen, sei der Masterplan zur Stärkung der ambulanten ärztlichen Versorgung in Rheinland-Pfalz entwickelt worden. Dieser umfasse aktuell mehr als 30 unterschiedliche Maßnahmen, wie Förderprogramme, innovative Regelungen für das Medizinstudium oder auch Beratungs- und Qualifizierungsangebote, so der Minister. Dies geschehe in enger Zusammenarbeit auch mit KV RLP, Landesärztekammer, Landespsychotherapeutenkammer, Hausärzteverband Rheinland-Pfalz sowie der Mainzer Universitätsmedizin.
Zusammenarbeit mit Ärzteschaft und Kommunen
Damit eine Mobile Arztpraxis zum Einsatz kommt, müssen neben dem Bestehen eines nicht auffangbaren Versorgungsengpasses weitere Kriterien erfüllt sein. So erfolgt eine enge Abstimmung mit der Ärzteschaft vor Ort. Außerdem braucht es die Zustimmung der jeweiligen Verbandsgemeinde bzw. Stadt. Mit der Kommune schließt die KV RLP eine entsprechende Kooperationsvereinbarung. „Es ist überaus wichtig, mit den Akteurinnen und Akteuren in der betroffenen Region zusammenzuarbeiten. Schließlich ist es das Ziel, die bestmögliche Versorgung der Patientinnen und Patienten zu gewährleisten“, betont Dr. Heinz. Auch bei den Krankenkassen kommen die Mobilen Arztpraxen gut an. Sowohl die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse als auch die IKK Südwest unterstützen das Konzept.
-

 Allgemeinvor 2 Jahren
Allgemeinvor 2 JahrenRhein-Lahn-Kreis feiert 1. Mai – Wir waren in Dornholzhausen, Nievern, Hirschberg und Fachbach – Video im Beitrag
-

 VG Loreleyvor 3 Jahren
VG Loreleyvor 3 JahrenVG Loreley bietet Sommerfreizeit für Kinder aus den Flutgebieten
-

 Koblenzvor 3 Jahren
Koblenzvor 3 JahrenKoblenz beschließt neue Baumschutzsatzung
-

 Schulenvor 3 Jahren
Schulenvor 3 JahrenVG Bad Ems-Nassau investiert in die Sanierung der Turnhalle der Freiherr-vom-Stein Schule Bad Ems
-

 Gesundheitvor 2 Jahren
Gesundheitvor 2 JahrenPflegekammer RLP muss Beiträge an Mitglieder erstatten!
-

 Rechtvor 3 Monaten
Rechtvor 3 MonatenGnadenhof Eifel in Harscheid: 51 alte und kranke Hunde sollen ihr Zuhause verlieren!
-

 Gesundheitvor 4 Monaten
Gesundheitvor 4 Monaten190 Mitarbeiter werden ab morgen im Elisabeth-Krankenhaus in Lahnstein entlassen: Hospital wird zur Psychiatrie!
-

 Rhein-Lahn-Kreisvor 1 Jahr
Rhein-Lahn-Kreisvor 1 JahrBeamtinnen auf Lebenszeit ernannt