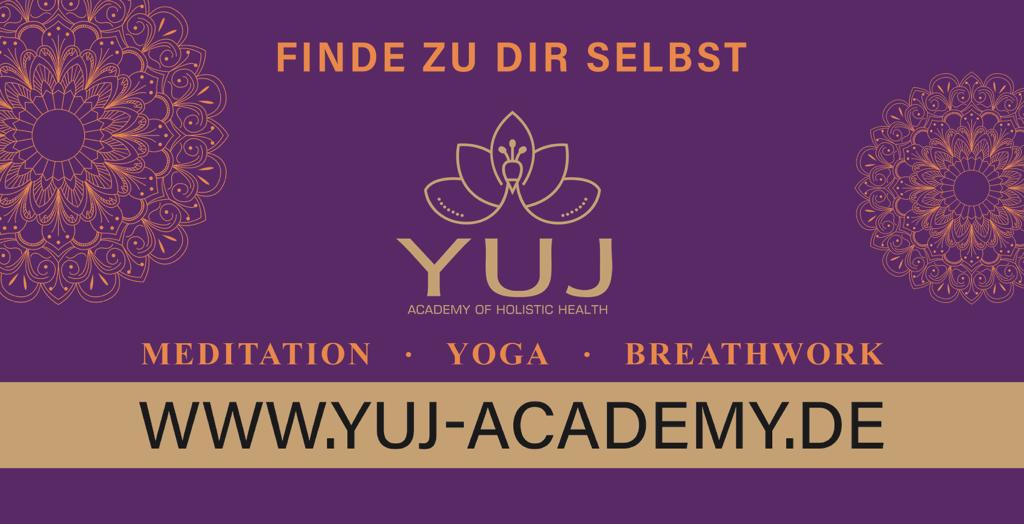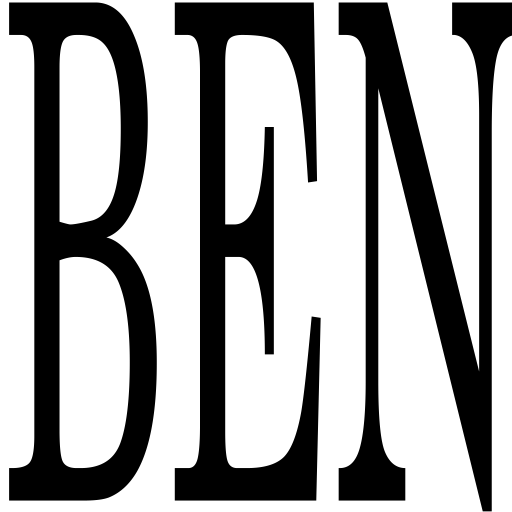Gesundheit
Hilfe für Schwangere & Mütter: Caritas-Projekt Hebammensprechstunde in Montabaur ist gut angelaufen
 Sie bieten jeden zweiten Dienstag im Monat die Hebammensprechstunde im Caritas-Beratungszentrum in Montabaur an: Susanne Thielheim (sitzend) und Mareike Römer. Foto: Caritasverbandes Westerwald-Rhein-Lahn / Holger Pöritzsch
Sie bieten jeden zweiten Dienstag im Monat die Hebammensprechstunde im Caritas-Beratungszentrum in Montabaur an: Susanne Thielheim (sitzend) und Mareike Römer. Foto: Caritasverbandes Westerwald-Rhein-Lahn / Holger Pöritzsch
MONTABAUR Eine Schwangerschaft löst ganz unterschiedliche, oft gegensätzliche Gefühle und Gedanken aus: Freude und Angst, Hoffnungen und Befürchtungen, Aufbruch in Neues und Abschied von Gewohntem. Ganz sicher aber bringt eine Schwangerschaft Veränderungen mit sich. In dieser Situation ist es wichtig, Unterstützung zu erfahren. Diese finden Hilfesuchende bei der katholischen Schwangerschaftsberatung der Caritas. Sie steht allen Frauen, Männern und Paaren offen. Vor rund einem Jahr wurde das Angebot erweitert: mit einer regelmäßigen Hebammensprechstunde.
Die hohe Auslastung der Hebammen vor Ort ist ein Problem. Dies stellen die Schwangeren-Beraterinnen des Caritasverbandes Westerwald-Rhein-Lahn immer wieder in ihrem Beratungsalltag fest. Frauen brauchen nach der Geburt, gerade wenn es um das erste Kind geht, eine entsprechende Nachsorge. Die Beraterinnen stehen im guten Kontakt mit den Hebammen in der Region und versuchen bereits sehr früh in der Schwangerschaft eine Hebamme zu vermitteln oder weisen darauf hin, rechtzeitig mit der Suche zu beginnen. „Es wird zunehmend aber zeitaufwendiger und schwieriger Hebammen zu finden, die noch Kapazität für die Nachsorge haben“, berichtet Astrid Schmidt aus der Praxis. Die Caritas-Beraterin erklärt: „Viele arbeiten neben ihrer ambulanten Hebammentätigkeit auch im klinischen Bereich mit Schicht- und Wochenenddienst. Dies hat zum Ergebnis, dass sie zeitlich stark belastet sind und die Nachsorge begrenzen müssen.“ Zudem hätten viele Hebammen ihre ambulante Hebammentätigkeit gänzlich beendet und stünden nicht mehr zur Verfügung. „Besonders problematisch ist diese fehlende Betreuung für die Frauen mit Fluchthintergrund“, sagt Schmidt und betont, dass die Ansprechpartner dieser Frauen in deren Heimat meist im familiären Umfeld zu finden sind. „Da dieses Umfeld hier aber fehlt, ist eine Hebamme gerade für diese Frauen eine wichtige und notwendige Ansprechpartnerin“, so die Caritas-Beraterin.
Um diese Versorgungslücke für Schwangere und Mütter zu schließen, hat die Caritas die Hebammensprechstunde ins Leben gerufen. Mit ihr sollen zudem Hemmschwellen abgebaut werden, die Schwangere und Mütter daran hindern könnten, die Hilfe einer Hebamme in Anspruch zu nehmen. Die Sprechstunde dient dem Kennenlernen der Hebammen und zur Hinführung zum Angebot der Hebammenhilfe. Das Projekt wird in Kooperation mit der Hebammenpraxisgemeinschaft Montabaur umgesetzt. Jeden zweiten Dienstag stehen die beiden erfahrenen Hebammen Susanne Thielheim und Mareike Römer den Schwangeren sowie Müttern mit Rat und Tat zur Seite. Natürlich können auch die Partner der Frauen an der Sprechstunde teilnehmen. Dies sei allerdings eher die Seltenheit, wie Thielheim und Römer berichten. „Je nach Herkunftsland, wissen die Frauen nicht mal, was eine Hebamme ist“, sagen sie. Dafür aber sind die Frauen für jeden Tipp und jede Hilfe dankbar. Die Themen sind vielfältig: Mal geht es um Fütterungsschwierigkeiten, mal um Stillprobleme, mal haben die Frauen behördliche Fragen. „Die kostenlose Hebammensprechstunde bereichert das Angebot unserer Schwangerschaftsberatung. Das Projekt ist gut angelaufen und soll nun weiter etabliert werden“, unterstreicht Astrid Schmidt.
Weitere Infos gibt es bei der katholischen Schwangerschaftsberatung im Caritas-Zentrum in Montabaur unter Telefon 02602/160615 oder 160617 sowie per Mail an schwangerenberatung-ww@cv-ww-rl.de.
Gesundheit
Til kämpft sich ins Leben zurück: Ehemaliger Koblenzer Patient trifft nach 22 Jahren seine Retter

KOBLENZ „Er ist ein Kämpfer!“ Damit meint Frank Simonis seinen Sohn Til, den er liebevoll anschaut, als er mit ihm, Ehefrau Astrid und Tochter Lea im Kemperhof, dort wo Til zur Welt kam, zu Besuch ist. Gemeinsam sind die vier einen beeindruckenden Weg gegangen.
Til kommt am 4. Mai 2002 in der 28. Schwangerschaftswoche als Frühchen zur Welt. „Diese Kinder hatten bereits vor 22 Jahren gute Überlebenschancen. Doch Til entwickelte plötzlich unter intensivierter Beatmung einen beidseitigen Lungenriss mit Herz-Kreislaufversagen“, erklärt Dr. med. Thomas Hoppen, der die Familie 2024 zum Wiedersehen im Kemperhof trifft.
„Als meine Frau mich anrief und sagte, was passiert ist, war für mich klar: Til schafft das, der ist ein Kämper“, erinnert sich Vater Frank. Doch so sicher war das keinesfalls. „Ohne ein eingespieltes Team, das schnell und effizient reagiert, hätte die Geschichte ganz anders ausgehen können“, weiß Hoppen. Wichtig war, dass gleich mehrere Behandlungen nahezu parallel verliefen: die sofortige kontinuierliche Wiederbelebung mit Überdruckbeatmung und Herzdruckmassage, die Notfallmedikamentengabe und die Versorgung beider Lungen mit Schläuchen durch die Haut bis in den Lungenspalt, damit sich beide Lungen wieder entfalten konnten.
Das Besondere: „Die Lungen sind bei so kleinen Kindern winzig, aber definitiv lebenswichtig für den Atemgasaustausch – also vor allen Dingen für die Versorgung mit lebenswichtigem Sauerstoff. Da gilt es, dran zu bleiben und nicht nach zehn Minuten zu sagen ,wir schaffen das nicht‘ “, erläutert der Facharzt für Pädiatrische Intensivmedizin.
Als Til dieses Jahr die Geschichte noch einmal hört und neben ihm Hebamme Christine und Arzt Thomas zur Seite stehen, ist er überwältigt. „Das ist einfach Wahnsinn“, sagt er. „Ich freue mich so unglaublich, dass ich das Team jetzt kennenlernen darf.“
Das Team hat Til nach der Reanimation noch weitere rund zehn Wochen begleitet. „Wir waren damals sehr erleichtert und überglücklich, dass es unser Til geschafft hat. Und gleichzeitig war es eine sehr aufwühlende und kräftezehrende Zeit“, erinnert sich Mutter Astrid. „Da hätten wir uns damals auch gewünscht, wenn andere Familien von ihren Erlebnissen erzählt hätten. Das bewegt uns, auch heute noch nach so langer Zeit, anderen Mut zu machen“, sagt die Familie.
Geschichten wie diese sind kein Alltag, aber in einem Perinatalzentrum Level 1, wie es der Kemperhof ist, kommen jährlich eine Reihe von Frühgeborenen zur Welt. „In unserem Zentrum sind Fachärzte mit spezieller Zusatzweiterbildung für Geburtshilfe und Perinatalmedizin sowie für Neonatologie rund um die Uhr erreichbar. Auf der neonatologischen Intensivstation haben wir mindestens sechs Intensivpflegeplätze und entsprechend ausgebildetes Personal, sodass eine optimale Versorgung gesichert ist“, betont Chefarzt Privatdozent Dr. med. Thomas Nüßlein.
Er und das gesamte Team haben sich sehr gefreut, dass Til zu Gast war. „Es war auch für mich sehr bewegend. Tils Geschichte zeigt auch, wie enorm wichtig es ist, dass möglichst viele für den Notfall geschult sind – nicht nur im Krankenhaus“, betont Hoppen. Deshalb bietet er auch seit Jahren im Kemperhof regelmäßig Notfalltrainings mit Kinder-Simulationspuppen an. „Jeder sollte an seinem Können arbeiten und regelmäßig an einem solchen Kurs teilnehmen.“
Gesundheit
Rechtsextreme Parolen sind mit Pflegeberuf unvereinbar: Caritasverband und katholische Altenhilfe setzen ein Zeichen

RHEIN-LAHN |WESTERWALD Die Mitglieder des Verbandes katholischer Altenhilfe in Deutschland machen klar: Pflege ist vielfältig und international. Menschenfeindlichkeit und die Verbreitung rechtsextremer Parolen sind mit dem Pflegeberuf unvereinbar. Die Mitgliederversammlung des Verbandes katholischer Altenhilfe in Deutschland (VKAD) hat kürzlich eine Resolution verabschiedet, die sich klar zu Demokratie und Mitmenschlichkeit in den Einrichtungen und Diensten der Altenhilfe bekennt. Der Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn e.V. unterstützt diese Haltung aus voller Überzeugung.
Pflege bedeutet Fürsorge und Zusammenhalt, nicht Spaltung
Caritasdirektorin Stefanie Krones sagt: „Die Europawahl und die Kommunalwahlen haben gezeigt, dass wir unermüdlich für demokratische Werte und für Mitmenschlichkeit einstehen müssen. Als Träger sozialer Dienstleistungen für Menschen mit Unterstützungs- und Pflegebedarf sind wir eine Säule der Daseinsvorsorge in unserem Land. Wir stehen für Fürsorge und Zusammenhalt, nicht Spaltung.“
Gemeinsam stehen die katholischen Einrichtung und Dienste für die Würde jedes einzelnen Menschen ein. Das gilt auch für die Mitarbeitenden und Auszubildenden, die aus vielen verschiedenen Nationen kommen und unsere Gemeinschaft bereichern. Stefanie Krones betont: „Unseren internationalen Azubis bieten wir in der Region nicht nur einen Ausbildungsplatz, sondern auch eine wirkliche Heimat.“
Die Verbreitung rechtsextremer Parolen ist mit einem Dienst in den katholischen Einrichtungen und Diensten unvereinbar
„Unsere Mitglieder machen deutlich, dass die Verbreitung rechtsextremer Parolen – dazu gehören insbesondere Rassismus und Antisemitismus – mit einem haupt- oder ehrenamtlichen Dienst in den katholischen Einrichtungen und Diensten unvereinbar ist.“ Caritasdirektorin Stefanie Krones ist aktiv im Vorstand des VKAD und hat die Resolution mit verfasst.
Der Verband katholischer Altenhilfe in Deutschland e.V. (VKAD) vereint rund 500 Träger der katholischen Langzeitpflege in Deutschland. Der bundesweit tätige Fachverband innerhalb des Deutschen Caritasverbandes vertritt die Interessen seiner Mitglieder durch politische Lobbyarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und fachliche Expertise.
Der Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn e.V. ist ein modernes und zukunftsorientiertes Sozialunternehmen mit vielfältigen Arbeitsbereichen und mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden einer der größten Anbieter sozialer Dienstleistungen in der Region.
Gesundheit
Eine Erfolgsgeschichte: Das KS Medical in Nassau feierte sein drittes Fest!

NASSAU Zum nunmehr dritten Mal feierte das KS Medical Center in Nassau ein großes Fest und das ist ein richtig gutes Zeichen, denn beim ersten Mal ist es eine Premiere, beim zweiten Mal, eine Wiederholung und beim dritten Mal eine feste Veranstaltung und so darf man sich schon jetzt auf die gesundheitlichen Fortschritte am Standort für 2025 freuen.
Bei Würstchen und kalten Getränken durften die zahlreichen Besucher das komplette medizinische Center erkunden. In den unteren Etagen befindet sich die PuraVita mit ihren Arbeitstherapien für Menschen mit psychischer Einschränkung. Bei einem herrlichen Cocktail kam man mit den Mitarbeitern ins Gespräch und durfte parallel große Handwerkskunst der Heimbewohner bestaunen. So geht es zurück in den ersten Arbeitsmarkt.

Gleichzeitig feierte auch 2nd Chance mit seinem Restpostenmarkt sein 2-jähriges Jubiläum. Ebenfalls eine Erfolgsgeschichte, doch bleiben wir ein wenig beim Gesundheitsstandort. »Wir haben vor vier Jahren das ehemalige Marienkrankenhaus übernommen und zum Gesundheitsstandort ausgebaut«, teilt der ansässige Allgemeinmediziner Dr. Thomas Klimaschka mit. »Mittlerweile ist das KS Medical Center zu Zweidritteln belegt.«
Neben der Gemeinschaftspraxis im Nassauer Land und der PuraVita ist auch eine Physiotherapiepraxis im Haus, eine psychiatrische Institutsambulanz mit Tagesklinik, dazu ist der Gastroenterologe Dr. Münzel aus Bad Ems einen Tag die Woche vor Ort und zusätzlich gibt es noch eine Heilpraktikerin in den Räumlichkeiten.
So ist das KS Medical längst zu einem vollwertigen medizinischen Versorgungszentrum geworden, das vom Angebot mittelfristig noch weiter ausgebaut wird. Gerade durch solche vorhandenen Angebote können weggefallene Therapien des geschlossenen Paracelsus-Krankenhauses in bad Ems zu Teilen aufgefangen werden, ohne dass die Menschen bis nach Koblenz oder weiter fahren müssen.
Schon jetzt darf man sich auf das Fest im kommenden Jahr freuen, denn bis dahin wird sich das KS Medical in Nassau weiter gut entwickeln. Eine schöne Erfolgsgeschichte.
-

 Allgemeinvor 2 Jahren
Allgemeinvor 2 JahrenRhein-Lahn-Kreis feiert 1. Mai – Wir waren in Dornholzhausen, Nievern, Hirschberg und Fachbach – Video im Beitrag
-

 VG Loreleyvor 3 Jahren
VG Loreleyvor 3 JahrenVG Loreley bietet Sommerfreizeit für Kinder aus den Flutgebieten
-

 Koblenzvor 3 Jahren
Koblenzvor 3 JahrenKoblenz beschließt neue Baumschutzsatzung
-

 Schulenvor 3 Jahren
Schulenvor 3 JahrenVG Bad Ems-Nassau investiert in die Sanierung der Turnhalle der Freiherr-vom-Stein Schule Bad Ems
-

 VG Nastättenvor 2 Wochen
VG Nastättenvor 2 WochenLandwirt hat Tiere nicht im Griff: Kühe brechen immer wieder auf den Segelflugplatz Nastätten aus
-

 Gesundheitvor 2 Jahren
Gesundheitvor 2 JahrenPflegekammer RLP muss Beiträge an Mitglieder erstatten!
-

 Rechtvor 5 Monaten
Rechtvor 5 MonatenGnadenhof Eifel in Harscheid: 51 alte und kranke Hunde sollen ihr Zuhause verlieren!
-

 Gesundheitvor 5 Monaten
Gesundheitvor 5 Monaten190 Mitarbeiter werden ab morgen im Elisabeth-Krankenhaus in Lahnstein entlassen: Hospital wird zur Psychiatrie!