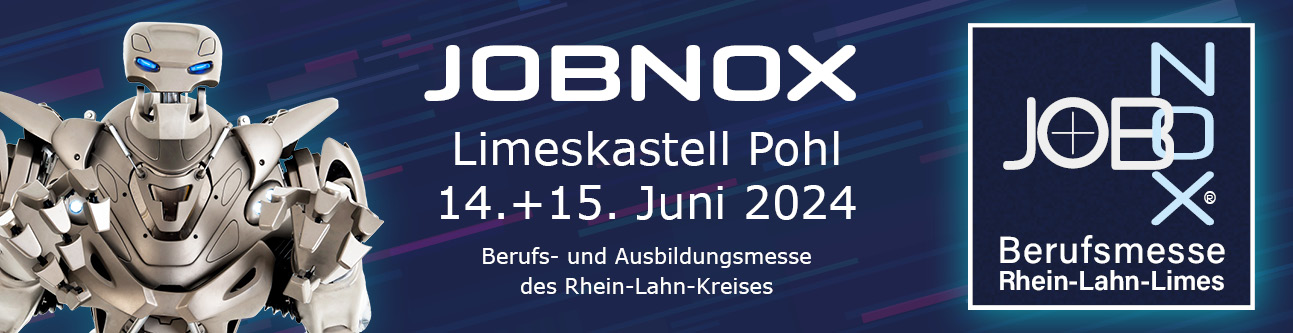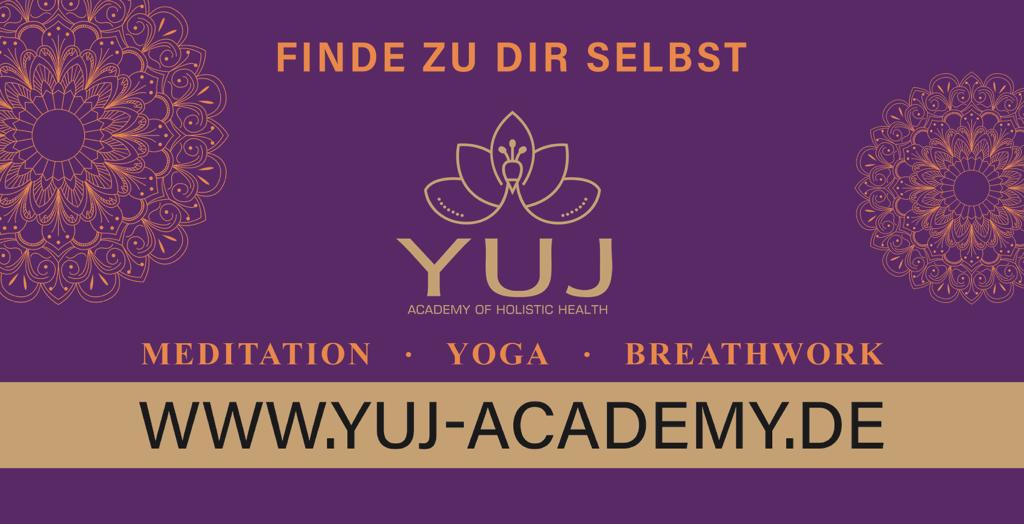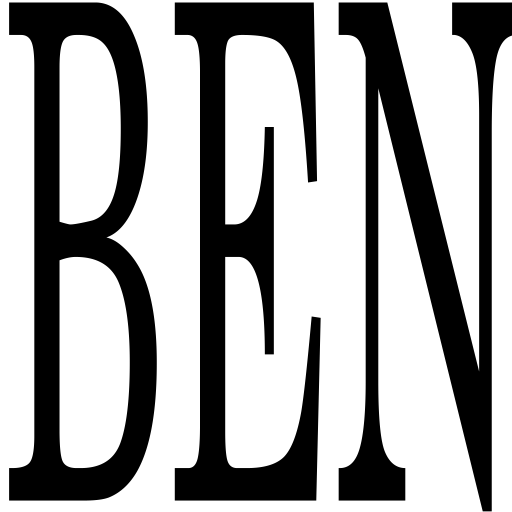Politik
Existenz gefährdet? Schlachthof Bayer kritisiert mögliche Gebührenerhöhung für Fleischbeschau!
 Existenz gefährdet? Schlachthof Bayer kritisiert mögliche Gebührenerhöhung für Fleischbeschau! (Foto: Pixabay -Symbolbild)
Existenz gefährdet? Schlachthof Bayer kritisiert mögliche Gebührenerhöhung für Fleischbeschau! (Foto: Pixabay -Symbolbild)
BAD EMS Der Kreisausschuss plant eine Erhöhung der Fleischbeschaugebühren für den Rhein-Lahn-Kreis. Während sich für Kleinbetriebe und Hausschlachtungen an der Preisstruktur nichts ändern soll, sollen gewerbliche Großbetriebe in Zukunft bei der Rinderfleischbeschau deutlich mehr bezahlen. Die angesetzten Gebühren bei der Schweineschlachtung sollen von 2,14 EUR auf 3,05 EUR steigen. Bei Rindern von 5,00 EUR auf 13,47 EUR.
Gerechnet nach den Schlachtzahlen aus dem Jahr 2023 würde das für 2024 etwa 67.000 EUR mehr an finanziellen Aufwendungen für den Betrieb Bayer in Niederwallmenach bedeuten. Spielraum für Erhöhungen der Verkaufspreise sieht das Unternehmen nicht mehr, da in der jüngsten Vergangenheit durch gestiegene Energiepreise und Mitarbeiterlöhne bereits Angleichungen der Verbraucherpreise gab. Die Firma befürchtet bei erneuten Preissteigerungen, dass die Kunden dauerhaft zu Wettbewerbern wechseln könnten.
Das Unternehmen kündigte an, den Standort Niederwallmenach aufzugeben, wenn es zu der geplanten Gebührenerhöhung kommen würde. Auch die Kostenbeteiligung des Schlachthofes in Höhe von etwa 400.000 EUR beim Ausbau der Kläranlage im Ort würde zwangsläufig entfallen. Der Geschäftsführer appellierte an die Kreistagsmitglieder, dass diese sich genau überlegen sollten, ob sie einer solchen neuen Gebührenordnung zustimmen wollen, denn wäre die Schlachtung in Niederwallmenach einmal eingestellt, gäbe es an diesem Standort keine Zukunft mehr.
Mittlerweile ruderten einige Kreistagsmitglieder zurück und wollen zunächst der Beschlussfassung nicht zustimmen. Ursprünglich sollte heute darüber entschieden werden, dazu wird es voraussichtlich nicht kommen. Besonders in den sozialen Medien bekam die Thematik eine Eigendynamik. Die Menschen entrüsteten sich über die mögliche finanzielle Belastung eines regionalen Anbieters. Vehement wurde für den Schlachthof in Niederwallmenach Partei ergriffen und Solidarität gezeigt.
Wettbewerbsungerechtigkeit für das Unternehmen Bayer oder jahrzentelanger Wettbewerbsvorteil gegen Mitbewerber?
Besonders in der geplanten Gebührenerhöhung sieht das Unternehmen eine Wettbewerbsungerechtigkeit. Wir haben uns einmal die Standorte von gewerblichen Großschlachtereien und die dort angesetzte Gebührenordnung in der Fleischhygiene angesehen, um einen Vergleich anzustellen. Und auch dort musste man deutlich unterscheiden, denn in vielen Kreisen gibt es keine gewerblichen Großschlachtbetriebe, und die Gebührenordnung ist primär auf die gewerblichen Kleinbetriebe abgestimmt. Wir haben uns ausschließlich an den Standorten mit gewerblichen Großbetrieben orientiert, um die Werte vergleichbar zu machen.
Schauen wir zunächst einmal auf die Gebührenordnung für Schweineschlachtungen. Der Rhein-Lahn-Kreis möchte von 2,14 EUR auf 3,05 EUR erhöhen. Günstiger ist es im Kreis Bernkastel-Wittlich. Bei angenommenen 1000 Schlachtungen pro Woche (Bayer Niederwallmenach) und 200 pro Tag bei einer 5-Tage-Woche würde der Betrieb in dem Kreis nur 1,71 EUR pro Schweineschlachtung bezahlen. In der Vulkaneifel (Eifelfleisch in Gerolstein) lägen die Kosten bei 2,80 EUR statt der angedachten 3,05 EUR. In Bad Kreuznach liegen die Gebühren bei beachtlichen 8,54 EUR. Schaut man dort ein wenig über das Bundesland hinauf auf die ganz großen Schlachtbetriebe wie Tönnies in Rheda-Wiedenbrück oder Westfleisch, wird es interessant. Bei angenommenen 30 Schlachtungen pro Stunde müsste Tönnies 4,37 EUR pro Schwein bezahlen. Westfleisch käme mit 3,03 EUR günstiger weg.
Ganz anders sieht es bei den Gebühren für Rinder aus. Bisher verlangte der Rhein-Lahn-Kreis 5,00 EUR für die Fleischbeschauung bei Rindern. Der nunmehr angedachte Preis liegt bei 13,47 EUR. Und genau dort wird die Vergleichbarkeit sehr schwierig. Das Unternehmen Bayer ist im Bereich der Rinderschlachtung kein großer Schlachtbetrieb, sondern ein kleiner Gewerbebetrieb. In den Kreisen wird primär nach Schlachtart unterschieden und gerade nicht zusammengezählt. So kommt es vor, dass ein Unternehmen bei der Schweineschlachtung so hohe Zahlen vorweisen kann, dass es als gewerblicher Großbetrieb eingestuft wird und bei der Rinder- oder Geflügelschlachtung deutlich schlechter dasteht, da dort die Verwertungszahlen deutlich geringer sind.
Eine Preiserhöhung von 5 Cent je Kilo würden die Verbraucher nicht mittragen?
Statt einer von dem Unternehmen Bayer angenommenen Wettbewerbsbenachteiligung bei einer Gebührenerhöhung, dürfte es sich vielmehr um einen jahrzehntelangen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Mitbewerbern gehandelt haben bei bisherigen 5,00 EUR pro Fleischbeschau bei einem Rind. Das Unternehmen gibt auf ihrer Webseite an, dass es zwischen 40 und 80 Rinderschlachtungen pro Woche durchführt. Wir haben uns angesehen, was für die Menge in anderen Kreisen mit Schlachthofgroßbetrieben aufgerufen wird.
Im Kreis Bernkastel-Wittlich werden ab einer Schlachtleistung von 120 Rindern pro Tag 22,29 EUR fällig. In Bad Kreuznach sind es ab 65 bis 119 Rinder pro Tag 14,12 EUR und in der Vulkaneifel 15,64 EUR bzw. 6,13 EUR ab 120 Schlachtungen pro Tag. Der Rhein-Lahn-Kreis möchte zukünftig möglicherweise auf 13,47 EUR erhöhen und wäre damit noch sehr günstig im direkten Vergleich. Das Bundesland Bayern hat dieses Jahr einen Gesetzentwurf zur Preisdeckelung bei den Gebühren nach dem Fleischhygienerecht verabschiedet. Damit sollen kleinere und mittlere Schlachthöfe entlastet werden. Vermieden werden sollen damit lange Transportwege. Regionale Schlachtstrukturen sollen gestärkt werden. Allerdings betrifft das nur Unternehmen mit bis zu 1000 Großvieheinheiten im Jahr. Da liegt das Unternehmen Bayer in Niederwallmenach auch bei den Rindern bei einer Leistung von 40 bis 80 Stück die Woche drüber. Bei ausgewachsenen Rindern soll der Preis bei 14,00 EUR liegen.
Während andere Kreise nach Jungrindern (deutlich günstiger) und ausgewachsenen Tieren unterscheiden, soll es im Rhein-Lahn-Kreis einen Einheitspreis geben. Und eines ist sicherlich klar: Regionalität ist ein gewichtiges Argument. Für die zuliefernden Landwirte bedeutet es kurze Wege und damit geringere Kosten und für die Verbraucher ist es die Möglichkeit, heimische Metzgerwaren zu konkurrenzfähigen Preisen zu bekommen. Ein Schlachthof im Kreis ist sicherlich ein Luxus, den zahlreiche andere Gemeinden gerne hätten.
Und trotzdem darf sich ein Kreis nicht beirren lassen. Insbesondere bei der Erhöhung der Gebühren zur Fleischbeschau bei Rindern ist der Schritt überfällig. Mit bisherigen 5,00 EUR konnte das kaum kostendeckend bei einer Schlachtleistung von 40 bis 80 Rindern die Woche gewesen sein. Ein ausgewachsenes Schlachtrind wiegt etwa 330 kg. Bei durchschnittlich angenommenen 48% Schlachtabfällen und einer Kostenerhöhung von 8,47 EUR je Rind wären das auf das Kilo brutto gerechnet rund 5 Cent. Und eine Preiserhöhung von 5 Cent je Kilo würden die Verbraucher nicht mittragen?
Gerade die gewerblichen Kleinbetriebe können nicht mit einem Unternehmen wie Bayer konkurrieren. Sie zahlen 20,00 bei Rindern ab 6 Schlachtungen und müssen sich in Nischen trotzdem dem Wettbewerb stellen. Bei bisherigen 5,00 EUR je Fleischbeschau und lediglich 40 bis 80 Schlachtungen von Rindern je Woche käme die Weiterführung der bisherigen Regelung einer versteckten Subvention des Kreises gleich. Bei dem angedachten neuen Preis von 13,47 EUR ist dieser noch immer über dem Kreis hinaus konkurrenzlos günstig, sofern man richtigerweise die Schlachtmenge beachtet.
Ein Shitstorm in den sozialen Medien beeindruckt scheinbar selbst gestandene Kreispolitiker
Die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Rhein-Lahn hofft auf legale Wege, das Unternehmen nicht weiter zu belasten, damit regionale Strukturen der Lebensmittelversorgung gesichert bleiben. Sie sieht besonders die Belastung durch den Fachkräftemangel, Energiepreis- und Lohnsteigerungen. Dazu sind immer mehr behördliche Anforderungen zu erfüllen. Im aktuellen Fall zur Firma Bayer führt sie die bereits 2017 eingeführte EU-Verordnung an, welche die Kreisverwaltung verpflichtet, die Gebührenstruktur anzupassen. Dabei wäre aber der Schuldige weder in der Kreisverwaltung noch im Land oder dem Bund zu suchen, denn immerhin handelt es sich um eine EU-Verordnung, die dem Tierschutz dienen soll. Bei der Tötung der Tiere müssen nach der erlassenen Verordnung dauerhaft ein Veterinär anwesend sein und ein weiterer müsste eine Probe entnehmen. Europäische Gesetze müssen vor Ort umgesetzt werden.
»Die Firma Bayer ist für unsere Region als regionaler Lebensmittelversorger, als Arbeitgeber, aber auch für unsere vielen regionalen Landwirte mit Viehhaltung ein wichtiges, höchst relevantes Unternehmen. Wertvolle Lebensmittelversorgung wird hier vor Ort sichergestellt. Als Wirtschaftsförderin bin ich der Meinung, dass jede mögliche Prüfung erfolgen muss, wie diese hohe, zusätzliche Kostenbelastung für die Firma Bayer reduziert werden kann. Gleichzeitig müssen wir uns bewusst sein, dass die durch Gesetz auferlegten Vorgaben eine Kostenumlage in Form von Gebühren erfordern; tut der Kreis das nicht, ist dies faktisch eine unerlaubte verdeckte Subvention mit ebenfalls weitreichenden Folgen. Es gilt in dieser Situation, alle Möglichkeiten auszuloten und gemeinsam mit Sachverstand legale Wege zu finden. Hilfreich wäre dabei schon, wenn die Exekutive in allen Ländern der EU, wo diese Verordnung und alle anderen Verordnungen wie bei uns gelten, deren Umsetzung ernsthaft kontrollieren würden. Andernfalls entstehen hier vor Ort Wettbewerbsnachteile und die, die sich an Recht und Gesetz halten, sind am Ende die Dummen«, teilt die Geschäftsführerin der WfG Rhein-Lahn mit.
Eine Überschrift in den sozialen Medien reichte aus, um einen donnernden Protest gegen die Pläne des Kreises auszulösen. Ein solcher Shitstorm beeindruckt scheinbar selbst gestandene Kreispolitiker. Nicht wenige knickten ein und versprachen, die Zustimmung zur Beschlussvorlage zu verweigern oder Nonkonformität ist unerwünscht und so schwimmen die Fische im Gleichklang ihres Abgesangs einer polarisierenden Nachricht hinterher, ohne zu hinterfragen. Das Phänomen der sozialen Medien. Nur darf ein Kreis sich davon erschüttern lassen oder ist er nicht dazu aufgerufen, gleiche Verhältnisse für alle zu schaffen, ohne das Ansehen des Unternehmens? Muss es nicht auch kostendeckend arbeiten?
Lokal ist längst zu einem Schlachtruf geworden. Und dennoch endet die Regionalität nicht an den Grenzen des Rhein-Lahn-Kreises. Viel zu gerne glaubt man, dass der Kreis eine Scheibe ist, von der man hinten herunterfällt. Hähnchen aus Schweighausen, Milch aus Endlichhofen und der Schnaps aus Hirschberg. Schön ist das. Doch in Zeiten der Globalisierung gehören auch die Äpfel aus der Eifel, der Wein von der Mosel und die Kirschen aus dem Rhein-Taunus-Kreis dazu. Und das am Besten zu ähnlichen Bedingungen. Und da sind wir wieder beim Schlachthof Bayer in Niederwallmenach.
Einen Wettbewerbsnachteil soll der Betrieb auf keinen Fall erleiden, aber auch keinen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil bei der Fleischbeschau von Rindern erlangen. Zudem darf die Entscheidung eines Kreisausschusses nicht davon abhängig gemacht werden, wie sich das Schwarmverhalten in den sozialen Medien entwickelt oder ob Druck auf ihn ausgeübt wird. Es bleibt abzuwarten, wie die Entscheidung des Kreises ausfällt, die heute sicherlich nicht getroffen wird.
Lahnstein
Landesdelegiertenversammlung von Bündnis 90/Die Grünen in Lahnstein

LAHNSTEIN Am vergangenen Samstag fand in der Stadthalle in Lahnstein die Landesdelegiertenversammlung von Bündnis 90/Die Grünen Rheinland-Pfalz statt. Der Kreisverband Rhein-Lahn und die Stadt Lahnstein waren mit einer großen Gruppe von grünen Parteimitgliedern bei der Veranstaltung vertreten.
 Anzeige
Anzeige Die Kreisvorsitzenden Yannik Maas und Jutta Niel hatten die Ehre, die Veranstaltung zu eröffnen. In ihrer Eröffnungsrede betonte Jutta Niel die Bedeutung von Fördergeldern für kommunalpolitische Aktivitäten. Sie verwies auf den Fördergeldbescheid, den Lahnstein aus dem ANK-Programm des Bundesumweltministeriums für die Renaturierung des Weihers auf der Lahnhöhe erhalten hat. Dies zeige, was durch Anträge und Fördergelder in der kommunalen Politik möglich ist und ermutige für die anstehende Kommunalwahl.
Die Grünen Rhein-Lahn setzen zusammen mit den Grünen im Land ein Zeichen für kommunale Politik und demokratische Beteiligung
Yannik Maas nahm Bezug auf den schwierigen Wahlkampf im Osten und bat und unterstrich die Bedeutung der Unterstützung und Solidarität für die Grünen im Wahlkampf in Thüringen. Gerade dort ist der Wahlkampf durch die starke Sympathie in der Bevölkerung für die AfD extrem fordernd. Er ermunterte die Parteifreunde und Freundinnen zum Kampf gegen rechtsextreme Tendenzen.
Dann startete die LDV mit verschiedenen Reden zu den Themen Kommunalpolitik, Rechtsextremismus und Europawahl. Jutta Paulus rheinland-pfälzische Spitzenkandidatin für die Europawahl, Tobias Lindner Staatsminister, Katrin Eder Staatsministerin ,der Landesvorstand mit Nathalie Cramme-Hill und Paul Bunjes und zahlreiche Mitglieder aus dem Bund- und Landesparlament hielten Reden zu den Themen Europa, Außenpolitik, Kommunalpolitik und zum Kampf gegen die Feinde der Demokratie.
Besonders hervorzuheben ist der Beitrag von Christin Sauer aus dem KV Mainz, die in ihrer Rede auf die Problematik im Kommunalwahlkampf gegen den aufkeimenden Faschismus einging. Sie machte deutlich, dass wir uns kurz vor den Kommunalwahlen nicht nur einer aufgeheizten Stimmung gegenübersehen, sondern auch gegen die Verunglimpfung demokratischer Beteiligung. Die Erzählung von “denen da oben”, die angeblich keine Ahnung haben, verfange und diffamiere die Politik an sich. Doch gerade in der kommunalen Politik, die zum Großteil im Ehrenamt stattfinde, seien wir nicht “die da oben”, sondern diejenigen, die wertvolle Zeit neben Job und Familie investieren, um eine bessere Zukunft vor Ort zu gestalten. Sie rief dazu auf, stolz darauf zu sein, was wir als kommunale Politikerinnen und Politiker leisten und dies auch nach außen zu vertreten.
Bündnis 90/Die Grünen Rhein-Lahn schließen sich den Worten von Christin Sauer an und freuen sich auf einen aktiven und engagierten Kommunalwahlkampf. Sie setzen ein Zeichen für kommunale Politik und demokratische Beteiligung und treten entschieden gegen rechte Tendenzen ein (Pressemitteilung: Bündnis 90/die Grünen Lahnstein)
 Foto: Bündnis 90/Die Grünen Lahnstein
Foto: Bündnis 90/Die Grünen Lahnstein Politik
SPD Nastätten stellt Stadtratsliste auf: Marco Ludwig als Stadtbürgermeisterkandidat gewählt

NASTÄTTEN In der Mitgliederversammlung am 18.032024 wählten die anwesenden Mitglieder die Kandidaten für das Amt des Stadtbürgermeisters sowie des Stadtrates in der kommenden Kommunalwahl. Der Vorsitzende des Ortsvereines Wolfgang Bärz freute sich, nicht nur Mitglieder der SPD zu begrüßen.
Mit einer großen Einigkeit wurde eine Liste ins Leben gerufen, die sowohl erfahrene Kommunalpolitiker als auch neue Kräfte zur Wahl stellt. Dabei ist es eben sehr erfreulich, dass junge Menschen, auch wenn Sie nicht der Partei angehören, sich für Nastätten engagieren möchten. Das ist gelebte Demokratie.
Frauen in der Kommunalpolitik keine Floskel
Mit rund 40% Frauenanteil auf den ersten zehn Plätzen ist diese Liste aber auch Sinnbild dessen, was in der Gesellschaft auch Platz findet. Frauen sind auf wichtigen Positionen auf dem Vormarsch. Frauen in der Kommunalpolitik sind immer noch unterrepräsentiert – im Arbeitsleben hat sich die Rolle schon stark gewandelt, auch wenn Luft nach oben ist. Hierbei setzt die SPD Blaues Ländchen ein Zeichen und setzt auf einen hohen Anteil kompetenter Frauen.
 Anzeige
Anzeige Deshalb gehen wir mit einer hoch motivierten und der Gesellschaft gerecht werdenden Liste ins Rennen um die Plätze im Nastätter Stadtrat. „Ich bin froh, dass die Liste sich so leicht gefüllt hat und wir keine langwierigen Überredungskünste brauchten, um Menschen vor Ort zu motivieren“, so der Fraktionsvorsitzende Gerd Grabitzke. Neben bekannten Gesichtern stellen sich zahlreiche neue Kandidaten dem Votum der Wählerinnen und Wählern.
Hierbei kann die SPD sehr gut platzierte und bekannte Bewerberinnen zählen. Hinter Marco Ludwig tritt Tina Behnert erstmals zur Wahl an. Mit Gerd Grabitzke folgt der jetzige Fraktionssprecher bevor die stellvertretende Vorsitzende des Kindergartenzweckverbandes Sabrina Lenz Platz 4 einnimmt. Wolfgang Bärz und Steffi Michel, beide sind bereits im jetzigen Stadtrat, kandidieren auf den Plätzen 5 und 6.
Auch aus den Neubaugebieten findet sich u.a. Benedikt Friesenhahn wieder und belegt mit Ursula Näther die nächsten Plätze. Dànos Ulbrich, Günter (Sammy) Soukup, Stephan Kratz, Jochen Zöller, Dr. Niko Näther und Silke Bärz verfügen bereits über mehrjährige Erfahrungen aus den Ausschüssen und dem Stadtrat. Sie wollen dies auch zukünftig tun.
Marco Ludwig als Stadtbürgermeisterkandidat gewählt
Sophia Seitz, bekannt als Freie Rednerin, stellt sich erstmals den Wählerinnen und Wählern. Es folgen Stefan Janzen, Beigeordneter der Stadt, Stephan Schmelz und Lukas Leitz. Die Liste komplettieren Detlev Schurwanz und Holger (Beppo) Weinmann, die sich beide ebenfalls in den verschiedensten Bereichen schon viele Jahre für die Stadt engagiert haben.
Mit der Stadtratsliste stand auch die Wahl zum Stadtbürgermeisterkandidat an. „Unser Bürgermeister ist nicht nur Verwaltungsfachmann, sondern hat trotz der enorm krisengeschüttelten Zeit unheimlich viel bewegt. Egal ob Verwaltung, KiTa, Gesundheitswesen, Wohnraum oder als Krisenmanager – er hat sich als Macher für die Stadt etabliert und daher gibt es keinen Zweifel, dass er weiter für uns aktiv sein soll“, hebt der Ortsvereinsvorsitzende Wolfgang Bärz den Kandidaten in seiner Rede hervor.
Seit der letzten Wahl 2019 ist Marco Ludwig Stadtbürgermeister im Mittelpunkt des Blauen Ländchens. Seit 1979, dem Amtsantritt von Karl Peter Bruch, ist er der dritte sozialdemokratische Bürgermeister in Nastätten. Dabei spricht die Entwicklung des Mittelzentrums für sich.
Dementsprechend eindeutig war auch das Wahlergebnis. „Ich bedanke mich für das große Vertrauen und bin wirklich sehr motiviert, unsere Stadt weiter zu entwickeln. Viel ist getan, aber es gibt noch viel zu tun. Das möchte ich gerne weiter anpacken“, bedankt sich Marco Ludwig beim Ortsverein.
Der SPD OV Nastätten hofft auf eine rege Wahlbeteiligung bei der „Mutter aller Wahlen“, die zusammen mit der Europawahl stattfindet.
„Eines ist mir wichtig: Bitte nehmen Sie ihr Stimmrecht wahr und gehen Sie wählen. Es ist das demokratische Grundrecht und wir sehen, was in Ländern, in denen dies nicht so ist, passiert. Kommunalwahl und Europawahl. Ein Pflichttermin für Demokratinnen und Demokraten“, so Stefan Janzen, Stadtrat und Beigeordneter, mit einem Appell an die Wählerschaft (Pressemitteilung: SPD Nastätten).
 Foto: SPD Nastätten
Foto: SPD Nastätten Lahnstein
SPD Lahnstein hofft auf schnelle Umsetzung des Windkraftprojekts

LAHNSTEIN Die SPD begrüßt die Unterzeichnung der Gestattungsverträge für das Gemeinschaftsprojekt Windpark Lahnhöhe zwischen der Stadt Lahnstein, den Gemeinden Becheln, Frücht und Schweighausen der VG Bad Ems-Nassau und der Energieversorgung Mittelrhein. “Wir hoffen, dass das Ziel, bereits 2028 die insgesamt 16 Windkraftanlagen ans Netz zu bringen, auch wirklich erreicht wird”, wünschen sich die SPD OV-Vorsitzende, Judith Ulrich und Jochen Sachsenhauser. Die Windräder sollen eine Nabenhöhe von rund 180 Meter haben und insgesamt ca. 270 Meter hoch sein. “Um den ambitionierten Zeitplan des Projekts so schnell wie möglich umzusetzen, müssen alle Akteure konstruktiv an der Umsetzung mitarbeiten”, betont SPD Umweltexperte Matthias Boller. Wichtig ist der SPD Lahnstein die Möglichkeit einer direkten Bürgerbeteiligung, damit neben der Stadt Lahnstein, die bis zu 2 Millionen Euro Pacht pro Jahr erhält, alle von dem Projekt profitieren. Um einen guten Klima- und Naturschutzeffekt zu erreichen, muss das Projekt schnellstmöglich umgesetzt werden können, weil dann auch durch die klimaschonende Stromerzeugung für umgerechnet ca. 200.000 Menschen ein wirklicher Beitrag zur Reduktion der Klimaerwärmung geleistet werden kann.
 Anzeige
Anzeige „Die SPD möchte einen nachhaltigen Beitrag zu geschlossenen Stoffströmen leisten, damit wir eine ökologisch stabile Basis und den sozialen Frieden erhalten”, betonen die stellvertretenden SPD OV-Vorsitzenden Perry Golly und Markus Graf. Aufgrund der zunehmend instabilen weltpolitischen Lage wird es immer wichtiger, autarke regionale, nachhaltige und stabile Energie-, Rohstoff- und Wirtschaftskreisläufe zu schaffen, um globale Abhängigkeiten zu reduzieren. Dadurch werden auch sichere Arbeitsplätze geschaffen und die Klimaerwärmung verlangsamt.
-

 Allgemeinvor 2 Jahren
Allgemeinvor 2 JahrenRhein-Lahn-Kreis feiert 1. Mai – Wir waren in Dornholzhausen, Nievern, Hirschberg und Fachbach – Video im Beitrag
-

 VG Loreleyvor 3 Jahren
VG Loreleyvor 3 JahrenVG Loreley bietet Sommerfreizeit für Kinder aus den Flutgebieten
-

 Koblenzvor 2 Jahren
Koblenzvor 2 JahrenKoblenz beschließt neue Baumschutzsatzung
-

 Schulenvor 2 Jahren
Schulenvor 2 JahrenVG Bad Ems-Nassau investiert in die Sanierung der Turnhalle der Freiherr-vom-Stein Schule Bad Ems
-

 Gesundheitvor 1 Jahr
Gesundheitvor 1 JahrPflegekammer RLP muss Beiträge an Mitglieder erstatten!
-

 Gesundheitvor 2 Monaten
Gesundheitvor 2 Monaten190 Mitarbeiter werden ab morgen im Elisabeth-Krankenhaus in Lahnstein entlassen: Hospital wird zur Psychiatrie!
-

 Rhein-Lahn-Kreisvor 1 Jahr
Rhein-Lahn-Kreisvor 1 JahrBeamtinnen auf Lebenszeit ernannt
-

 Lahnsteinvor 1 Jahr
Lahnsteinvor 1 JahrSorge vor Vollsperrung der B42 hält an