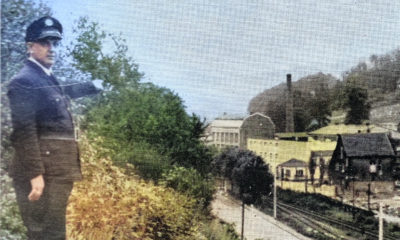Lahnstein
Auftaktveranstaltung 700 Jahre Stadtrechte Lahnstein: Festvortrag beeindruckte viele Zuhörer

LAHNSTEIN Vor 700 Jahren erhielt Oberlahnstein im Januar 1324 Oberlahnstein Stadtrechte. Um an dieses bedeutende Ereignis für die Stadtgeschichte zu erinnern, hat der Lahnsteiner Altertumsverein in Kooperation mit der Stadt Lahnstein am 01. März 2024 eine Veranstaltungsreihe begonnen, die insgesamt sechs Vorträge zu Themen der Stadtgeschichte bis in den Mai 2025 umfassen wird.
Am letzten Wochenende im Juni 2025 folgt dann ein großes Stadtfest, auf das Oberbürgermeister Lennart Siefert die rund 180 Zuhörer in der Stadthalle Lahnstein bei seiner Begrüßung hinwies. Er dankte dem Verein für seine Initiative und die Einladung des Referenten Prof. Dr. Gerhard Fouquet, der eigens aus Kiel angereist war. Dass Gerhardt Fouquet genau der richtige Spezialist zu dem Thema Stadtrechte ist, betonte Dr. Hubertus Seibert, 2. Vorsitzender des Lahnsteiner Altertumsvereins, in seiner kurzen Ansprache. Er dankte dem Oberbürgermeister und seinem Team für die gute Werbung, die ein nahezu volles Haus bescherte, und lud bereits zu den weiteren Vorträgen ein.
Gleich zu Beginn seines sowohl spannenden als auch hintergründigen Vortrags wies Prof. Fouquet darauf hin, dass neben Oberlahnstein auch weitere Städte in der Region, darunter Bad Ems und Kaub, vor 700 Jahren vom deutschen König Ludwig, der Bayer (ab 1328 Kaiser), Stadtrechte erhielten und nur acht Jahre später auch Niederlahnstein vom gleichen Herrscher sogar in einem Sammelprivileg mit weiteren 28 kurtrierischen Orten am Mittelrhein. Allerdings bedeutete die königliche Verleihung der Stadtrechte nicht automatisch für alle genannten Orte, dass sie wirklich „Stadt“ wurden. So blieb auch Niederlahnstein – wie viele der in der Urkunde von 1332 genannten Kommunen – bis zum Jahr 1885 ein Dorf, wenn auch durch zwei 1723 verliehene Jahrmärkte zum „Flecken“ erhoben, wie es im Fachjargon heißt. Erst durch die preußische Kreisordnung für die Provinz Hessen-Nassau von 1885 wurde Niederlahnstein endlich Stadt.
Folglich entwickelten sich das kurmainzische Oberlahnstein und das kurtrierische Niederlahnstein in ihrem Werden völlig unterschiedlich. Der Kurmainzer Landesherr hatte in Oberlahnstein bereits zuvor die Burg Lahneck (1245) und um 1300 die Zollburg (heutiges Martinsschloss) erbauen lassen, um den nördlichsten Teil seines territorial zersplitterten Kurfürstentums gegen die Machtansprüche der umliegenden Fürsten und Grafen zu verteidigen. Daher wurde bereits 1324 mit dem Bau der Stadtmauer und Türme begonnen, um die bedeutenden Zolleinnahmen zusätzlich gegen Angriffe abzusichern. Die Stadtbefestigung erwies sich schon bald als höchst effektives Bollwerk, da sie während der Mainzer Stiftsfehde im Oktober 1461 und im Sommer 1462 zwei Belagerungen durch Truppen des Trierer Erzbischofs Johann von Baden widerstand.
Der König verlieh, so Fouquet, bemerkenswerterweise nicht dem Stadtherrn, dem Mainzer Erzbischof, sondern den Bürgern Oberlahnsteins wie ihrem als Stadt („oppidum“) bezeichneten Gemeinwesen und dem mainzischen Amt das „ius universitatis“, das Recht zur Gemeindebildung mit einem eigenen städtischen Rat nach dem Vorbild der Reichsstadt Frankfurt am Main. Dieses Vorrecht erlaubte den Bürgern Oberlahnstein, auch Selbstverwaltungsorgane und eine eigene Satzungshoheit auszubilden.
Zu den weiteren Oberlahnstein verliehenen Rechten gehörte das „ius iudicii“, die Rechtsprechung über die eigenen Bürger im Sinne der niederen Gerichtsbarkeit, sowie das „ius fori“, das Recht auf einen Wochenmarkt. Außerdem erhielten die Bürger Oberlahnsteins für ihren Sachbesitz wie für ihre Person freies Erbrecht.
Doch die Nutzung all dieser Freiheitsrechte im politischen Alltag erwies sich als schwierig. So wurde die eigene Gerichtsbarkeit der Bürger nicht nur von den Mainzer Amtsleuten herrschaftlich erdrückt, die Oberlahnsteiner mussten noch bis zum Jahr 1442 warten, bis sich ein städtischer Rat und eine Ratsverfassung etablieren konnten.
Bis zum Jahr 1511 bildeten 14 Schöffen und 14 aus der Gemeinde auf Lebenszeit gewählte Männer den Rat. Da dieses Gremium für eine Stadt mit ca. 720 Einwohnern (betrifft das Jahr 1548) dem Erzbischof zu groß schien, verordnete er, dass neben den Schöffen nur noch sechs Ratsherren die Bürgergemeinde vertreten sollten. Diese Ratsherren wurden jedoch vom Kurfürsten bestimmt. Fouquet nannte dies „eine klare herrschaftliche Überformung von Rat und Gemeinde genauso wie die erzbischöfliche Amtsverwaltung die hohe Gerichtsbarkeit bei Raub und Mord unter weitgehender Ausschaltung der Vogteirechte der Grafen von Nassau an sich gebracht hatte.“ Der Erzbischof verfügte, dass alle Einnahmen und Ausgaben von Stadt und Spital, in Rechnungen geordnet, seinen mainzischen Amtleuten vorgelegt werden müssen. Bis ins Detail regelte die von ihm erlassene Stadtordnung von 1511, was die Bürger durften und was nicht, welche Abgaben sie zu zahlen hatten und vieles mehr.
Die Vergabe von Stadtrechten an viele Orte am Mittelrhein diente geistlichen und weltlichen Fürsten sowohl zur Sicherung ihrer Territorien und Einnahmen als auch zur Bekämpfung der Landflucht. Das kurtrierische Niederlahnstein blieb bis in die Neuzeit ein „Dorf“. Hier standen sich zwei Gruppen gegenüber: die bäuerliche Gemeinde der Heimbürgen und die Märkergenossenschaft der ansässigen Ortsadligen. Während die 14 auf Lebenszeit gewählten Heimbürgen den Schultheiß, den kurtrierischen Amtmann, bei der Verwaltung des Gemeindevermögens und der Nutzung von Flur und Allmende unterstützten, übten die über die bäuerliche Gemeinde dominierenden Ortsadligen die Kontrolle über den Ort aus und ernannten alle gemeindlichen Funktionsträger. Erst im 17. Jahrhundert verfiel deren Macht endgültig.
Freiheit und bürgerliche Rechte – so das Fazit des Vortrags – erhielten die Bürger nicht automatisch mit der Verleihung der Stadtrechte – sondern diese mussten über Jahrhunderte von ihnen erkämpft werden.
Im Anschluss an die interessanten Ausführungen lud die Stadt Lahnstein zum Umtrunk, den viele Zuhörer noch zum regen Austausch über den Vortrag und zum Gespräch mit dem Referenten nutzten.
Der nächste Vortrag im Rahmen der Reihe „Lahnstein im Wandel der Zeiten“, bei der namhafte Historikerinnen und Historiker spannende Einsichten in die Geschichte Lahnsteins vom Mittelalter bis zur Moderne bieten, findet am 21. Juni 2024 um 19.00 Uhr in der Hospitalkapelle Lahnsteins statt. Dr. Heidrun Ochs (Universität Mainz) referiert zum Thema „Vom Rechnen und Organisieren, Produzieren und Handeln zum Wirtschaften in den mittelrheinischen Städten Lahnstein, Boppard und Oberwesel um 1500“. Der Eintritt ist frei und keine Anmeldung erforderlich (Pressemitteilung: Stadt Lahnstein).
 Prof. Dr. Fouquet während seines Vortrags. (Foto: Bernd Geil | Stadtverwaltung Lahnstein)
Prof. Dr. Fouquet während seines Vortrags. (Foto: Bernd Geil | Stadtverwaltung Lahnstein) BEN Radio
Zum Jahreswechsel: Danke für Vertrauen, Hinweise und Kritik

RHEIN-LAHN Mit dem Übergang von 2025 zu 2026 endet für den BEN Kurier ein weiteres intensives Jahr regionaler Berichterstattung. Ein Jahr mit vielen Themen, Gesprächen, Recherchen und Geschichten aus unserer Heimat – getragen vor allem von den Menschen, die diese Region ausmachen.
Journalismus lebt vom Vertrauen der Leserinnen und Leser. Vom offenen Hinweis, von der kritischen Nachfrage, vom Widerspruch ebenso wie von der Zustimmung. Auch im vergangenen Jahr haben uns zahlreiche Hinweise erreicht, viele davon aus der Mitte der Gesellschaft. Sie haben Themen angestoßen, Missstände sichtbar gemacht, Entwicklungen begleitet und Diskussionen ermöglicht. Dafür sagen wir ausdrücklich Danke.
Der BEN Kurier versteht sich als unabhängiges regionales Medium. Unser Anspruch ist es, sachlich zu berichten, kritisch nachzufragen und Entwicklungen transparent darzustellen, unabhängig von parteipolitischen oder persönlichen Interessen. Gerade auf kommunaler Ebene ist dies nicht immer bequem, aber notwendig. Demokratie lebt von Öffentlichkeit, und Öffentlichkeit braucht verlässliche Informationen.
2025 war zugleich ein Jahr, das gezeigt hat, wie wichtig lokaler Journalismus weiterhin ist. Entscheidungen vor Ort, gesellschaftliche Debatten, ehrenamtliches Engagement, wirtschaftliche Herausforderungen und persönliche Schicksale, all das findet nicht abstrakt statt, sondern direkt vor unserer Haustür. Diese Nähe verpflichtet zu Sorgfalt, Verantwortung und Fairness.
Zum Jahreswechsel blicken wir mit Dankbarkeit auf das Erreichte und mit Verantwortung auf das Kommende. Auch 2026 wird der BEN Kurier aufmerksam hinschauen, zuhören und berichten. Nicht lauter als nötig, aber klar. Nicht gefällig, sondern verlässlich. Wir danken allen Leserinnen und Lesern für ihr Vertrauen, ihre Unterstützung und ihre kritische Begleitung.
Der BEN Kurier wünscht einen guten und sicheren Start ins Jahr 2026.
Lahnstein
Lahnsteiner Winterzauber begeisterte in der Adventszeit Fünf Wochenenden voller Weihnachtsstimmung

LAHNSTEIN Lahnstein hat in diesem Advent eindrucksvoll gezeigt, wie stimmungsvoll die Stadt leuchten kann. An fünf Wochenenden verwandelte sie sich in eine lebendige Winterwelt, die Menschen aus der Region wie aus der Nachbarschaft zusammenbrachte und mit warmem Licht, liebevoll dekorierten Plätzen und einer Fülle regionaler Kreativität begeisterte.
Der Winterzauber führte durch verschiedene Stadtteile und zeigte überall sein eigenes Gesicht: Mal durch romantisch geschmückte Höfe und kleine Gassen, mal durch historische Plätze, an denen Kunsthandwerk, kulinarische Leckereien und weihnachtliche Musik eine besonders heimelige Atmosphäre schufen. Kunsthandwerker aus der Region, Vereine, Initiativen und engagierte Bürgerinnen und Bürger machten jedes Wochenende zu einem kleinen Fest für alle Sinne.
Ob handgefertigte Geschenkideen, selbstgebackene Waffeln, traditionelle Spezialitäten oder kreative nachhaltige Produkte – der Winterzauber bot vielerorts liebevoll ausgewählte Angebote. Familien konnten sich über stimmungsvolle Kinderprogramme freuen, gemeinsames Weihnachtssingen sorgte für besondere Momente und sogar der Nikolaus ließ es sich nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen.
Den Abschluss bildete der Wintermarkt am Theater, der mit winterlichen Getränken, herzhaften wie süßen Speisen und kleinen Verkaufsständen einen stimmungsvollen Ausklang der Marktwochen schuf.
Die Wochenenden in Lahnstein luden auch zu einer besonderen Mitmachaktion ein: dem Schlemmerstempelpass. Für jede verköstigte Spezialität erhielten die Besucher einen Stempel. Ist der Pass vollständig gefüllt, konnte er direkt an den Verkaufsständen abgegeben oder in den vorgesehenen Lostopf eingeworfen werden. Damit haben alle Teilnehmer die Chance auf attraktive Gewinne, wie Ticktes für verschiedene Veranstaltungen in Lahnstein, Restaurantbesuche oder Sachpreise wie einen Schlitten und eine Kaffeemaschine. Alle Gewinner werden persönlich informiert.
„Der Winterzauber 2025 hat gezeigt, wie lebendig und herzlich unsere Stadt ist. Überall war zu spüren, wie Menschen miteinander ins Gespräch kommen und diese besondere Zeit des Jahres gemeinsam genießen. Ein toller Auftakt in die Weihnachtszeit, der sicher noch lange nachklingen wird“, freut sich Oberbürgermeister Lennart Siefert über die besondere Adventszeit in Lahnstein.
 Der Nikolausmarkt lockte viele Besucher auf den Salhofplatz | Foto: Aleksandra Szukala
Der Nikolausmarkt lockte viele Besucher auf den Salhofplatz | Foto: Aleksandra Szukala Wer die winterliche Atmosphäre auch nach den Adventswochenenden genießen möchte, hat dazu noch Gelegenheit: Der Krippenweg am Allerheiligenberg lädt bis zum 7. Januar zu besinnlichen Spaziergängen ein und verlängert so die festliche Stimmung über die Feiertage hinaus (pm Stadt Lahnstein).
BEN Radio
Vor 50 Jahren starb der Lahsteiner Willi Weiler als entschiedener Gegner des Nationalsozialismus

LAHNSTEIN Weniger bekannt ist, dass er als entschiedener Gegner des Nationalsozialismus zu den ersten politischen Gefangenen gehörte und bereits 1933 für ein halbes Jahr inhaftiert, gequält und gefoltert wurde. 1949 schrieb er die Broschüre „Meine Erlebnisse im KZ-Lager Kemna. Wuppertaler Lager der S.A.“. „Diese Schrift“, so schreibt er, „soll allen aufrechten Menschen eine Warnung sein, die Augen aufzuhalten, damit niemals mehr durch eine Diktatur die Freiheit geschunden und das Recht gebrochen wird.“ Seine Dokumentation wurde 1998 in einer Neuauflage einer breiteren Öffentlichkeit bekannt und ist im Stadtarchiv Lahnstein ausleihbar.
Geboren wurde Willi Weiler am 22. Mai 1905 in Kamp-Bornhofen. Er wurde Schiffsjunge, dann Matrose auf verschiedenen Rheinschiffen und erlangte 1929 das Rheinschifferpatent. Durch sein Elternhaus sozialistisch geprägt, wurde er bereits 1919 Mitglied der Gewerkschaft. Er beteiligte sich an Streiks im Ruhrgebiet, schloss sich Antifaschisten an und geriet bald ins Visier der aufkommenden Nationalsozialisten.
Nach der Machtergreifung wurde nach ihm gefahndet. Als er sich bei der Polizei meldete, kam er ins Stadtgefängnis Duisburg. Hier begann am 12. Mai 1933 sein Martyrium, dem Anfang September die Verlegung nach Kemna folgte. In einer leerstehenden Fabrik wurden von Juli 1933 bis zum Januar 1934 in der Mehrzahl kommunistische und sozialdemokratische Gegner des Hitler-Regimes aus Wuppertal, dem übrigen Bergischen Land sowie aus weiteren Städten und Regionen im Regierungsbezirk Düsseldorf inhaftiert. Was Willi Weiler und seine Leidensgenossen hier über sich ergehen lassen mussten, geht unter die Haut. Am 20. November 1933 wurde er aus dem Lager entlassen.
Willi Weiler musste schriftlich erklären, dass er „jede staatsfeindliche politische Betätigung, insbesondere jede Beteiligung an hoch- und landesverräterischen Umtrieben“ zu unterlassen habe. Weiler zog es vor, sich zunächst nach Holland abzusetzen. Ein holländischer Schiffsführer nahm ihn von Duisburg in seinem Maschinenraum mit. Später kehrte er nach Deutschland zurück. Er arbeitete bei der Deutschen Reichsbahn Oberlahnstein und wurde von hier als Fahrbereitschaftsleiter nach Le Mans im deutschbesetzten Frankreich versetzt. Als die Amerikaner vor Le Mans standen, setzte er sich mit drei Kameraden bis zur Grenze ab. Der Fußmarsch führt sie nach Wuppertal, wo er von einem Freund erfuhr, das nach ihm gefahndet wird, weil er „sich böswillig von der Truppe entfernt habe.“ Er beschloss, vorsichtig zu sein und daher nicht sofort nach Hause, sondern wegen seiner Gefäßerkrankung nach Bad Ems zu gehen. Dort hörte er von einem Geheimlazarett des Hautarztes Dr. Grochocki aus Koblenz, in dem er sich mit anderen politisch verfolgten Menschen gesundpflegen ließ.
Nach Kriegsende bewarb er sich zum Aufbau einer „politisch einwandfreien“ Polizei. Im August 1945 wurde er Kreiskommissar der französischen Militärregierung, zuständig für 52 Gemeinden im damaligen Kreis St. Goarshausen. 1948 wurde er vom Oberstaatsanwalt in Wuppertal zur Vernehmung geladen und traf vor dem Landgericht auf viele Leidensgenossen, die noch Nachwehen von den Misshandlungen aufwiesen. Als Zeuge musste er seinen einstigen Peinigern gegenübertreten. In dieser Zeit besuchte er sein einstiges Lager und schrieb mit Genehmigung der Militärregierung seine Erlebnisse nieder.
Da er keine Ausbildung zum Polizeibeamten hatte, nahm er 1948/49 an einem Polizeilehrgang in Bad Ems teil, der ihm vom Land Rheinland-Pfalz angeboten wurde. Jedoch fielen sämtliche Teilnehmer durch die Prüfung, worauf auch ihm gekündigt wurde. Weiler glaubte, dass die Entlassung aus dem Polizeidienst nicht mit rechten Dingen zuging. Spielte sein Buch, das von der Staatsanwaltschaft Koblenz überprüft wurde, dabei eine Rolle? Er prozessierte vor Gericht, verlor und rekapitulierte verbittert seine Machtlosigkeit gegenüber den „Drahtziehern“.
Bis zu seiner Rente arbeite Weiler bei den Lahnsteiner Firmen Bollinger, Schroeder und Stadelmann, Condor-Werke/Philippine als Lagerist und Pförtner. Ehrenamtlich sammelte er Geld- und Sachspenden für das Kinderferienlager der AWO auf dem Aspich, welches er als Rentner einige Jahre leitete. Am 16. Dezember 1975 verstarb Willi Weiler.
Von seiner Veröffentlichung erfuhr der „Jugendring Wuppertal e.V. Arbeitskreis Kemna“ durch Zufall erst lange nach Weilers Tod. Er nahm Kontakt mit der Stadt Lahnstein auf, wo Weiler mit seiner Familie bis zu seinem Tod lebte. Der Arbeitskreis entschied sich für einen Neudruck, zu dem die Töchter Weilers ihre Genehmigung sowie eigene Aufzeichnungen zum Lebenslauf des Vaters gaben. Die authentische Neuauflage, ergänzt durch Fotos und andere Zeitdokumente, verdeutlicht im Nachwort, dass Weilers Benachteiligung im beruflichen Leben nach 1945 leider kein Einzelfall ist (pm Stadt Lahnstein).
-

 Allgemeinvor 4 Jahren
Allgemeinvor 4 JahrenRhein-Lahn-Kreis feiert 1. Mai – Wir waren in Dornholzhausen, Nievern, Hirschberg und Fachbach – Video im Beitrag
-

 VG Loreleyvor 4 Jahren
VG Loreleyvor 4 JahrenVG Loreley bietet Sommerfreizeit für Kinder aus den Flutgebieten
-

 Schulenvor 4 Jahren
Schulenvor 4 JahrenVG Bad Ems-Nassau investiert in die Sanierung der Turnhalle der Freiherr-vom-Stein Schule Bad Ems
-

 Koblenzvor 4 Jahren
Koblenzvor 4 JahrenKoblenz beschließt neue Baumschutzsatzung
-

 Blaulichtvor 4 Monaten
Blaulichtvor 4 MonatenMillionenschäden bei Glasfaserausbau: Subunternehmer aus dem Rhein-Lahn-Kreis warten auf Gelder von Phoenix Engineering
-

 Koblenzvor 8 Monaten
Koblenzvor 8 MonatenKoblenz ausgebremst: Geplante Zug-Offensive scheitert an Bauchaos
-

 VG Nastättenvor 4 Jahren
VG Nastättenvor 4 JahrenAus für Endlichhofmilch? Zellmanns Birkenhof in Endlichhofen meldet Insolvenz an!
-

 VG Nastättenvor 1 Jahr
VG Nastättenvor 1 JahrLandwirt hat Tiere nicht im Griff: Kühe brechen immer wieder auf den Segelflugplatz Nastätten aus