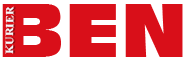Gesundheit
Kenny spendet Knochenmark – Leben retten kann so einfach sein! – Eine interessante Geschichte aus dem Rhein-Lahn-Kreis
 Zubereitungsset Hormonpräparat G-CSF
Zubereitungsset Hormonpräparat G-CSF
RHEIN-LAHN Es ist ein Donnerstagnachmittag und ich lege gerade meinen Sohn zum Mittagsschlaf, als wir einen Anruf bekommen. Irgendjemand von der DKMS wolle etwas von mir, teilt mir meine Frau mit. Die DKMS ist die Deutsche Knochenmarksspenderdatei. Diese Organisation ist eine von ungefähr 30 in Deutschland, die sich um die Knochenmarksspende kümmert, einem Verfahren das in den 1960er-Jahren entwickelt wurde um Krankheiten wie Leukämie, im Volksmund als Blutkrebs bekannt, sowie andere schwere Erkrankungen zu behandeln. Bis Ende der 1980er Jahre bedeutete die Diagnose und Behandlung Blutkrebs in vielen Fällen den Tod, da die Nebenwirkungen schwer in den Griff zu bekommen waren und das Verfahren kompliziert war.
Aber das hat sich geändert. Auch dank der DKMS. Überrascht gehe ich ran, jahrelang hatte ich die Spenderkarte im Portmonee und habe sonst keinen Gedanken daran verschwendet. Es ist fast zwanzig Jahre her, dass ich mich als Spender registriert habe. Als junger Soldat waren Dinge wie Blutspende, Typisierung und andere solidarische Möglichkeiten für mich und meine Kameraden selbstverständlich. Vor einigen Jahren habe ich das letzte Mal an die DKMS im Rahmen eines Umzugs gedacht und meine Daten aktualisiert. Denn der Datenschutz wiegt schwer bei der DKMS und wenn jemand unbekannt verzieht ist es quasi unmöglich für die Mitarbeiter den- oder diejenige ausfindig zu machen.
Das Problem dabei: Für die Spende benötigt man jemanden, der sehr viele spezielle genetische Merkmale mit dem Empfänger teilt, so ein bisschen vorstellbar wie bei einem Zwilling. Bei mehr als 20.000 verschiedenen Genen ist die Chance auf eine Übereinstimmung also gering. Und wenn derjenige, der passen würde registriert und unbekannt verzogen ist, ist das für die Mitarbeiter frustrierend. Denn dahinter stehen Schicksale, Schmerz und Leid und eben dann in vielen Fällen auch der Tod. Daher sollten auch bereits registrierte Personen ihre Daten regelmäßig abgleichen.
Ich führe mit der Frau von der DKMS ein ungefähr 15-minütiges Telefonat. Dabei gleicht sie Gesundheitsdaten ab, stellt mir einige medizinische Fragen nach meiner Konstitution und klärt
mich über den Ablauf des Verfahrens auf. Klar wird direkt eines: Die Ernsthaftigkeit des Verfahrens. Meine bisher gesammelten Daten ergeben die Möglichkeit, dass ich als Spender in
Frage käme. Ob das aber so ist muss in weitergehenden Untersuchungen geklärt werden. Der Patient erfährt über diese Suche und ihren Erfolg bzw. Misserfolg erstmal nichts, da die emotionale Belastung immens wäre und die Suche aufwendig ist. Denn gespendet und gesucht wird weltweit und nicht nur auf Deutschland begrenzt. Alles anonymisiert, auch die Mitarbeiter der DKMS wissen nur das nötigste.

Zubereitungsset Hormonpräparat G-CSF
Innerhalb eines Tages bekomme ich ein kleines Päckchen zugesendet mit Infomaterial, Briefen für meinen Hausarzt und Röhrchen für eine Blutentnahme. Beim Arzt bekomme ich sofort einen Termin für die Untersuchung, man nimmt mich dazwischen und behandelt mich gut. Jedem Beteiligten ist klar, dass es um Zeit, Leben und Tod geht. Die entstehenden Kosten übernimmt dabei komplett und unbürokratisch die DKMS. Wobei die Arzthelferin, welche mir Blut abnimmt mir mitteilt, dass sie das umsonst machen und nicht abrechnen. Denn die Arbeit der DKMS ist gemeinnützig, es geht nicht um Profite und die Prozesse sind aufwendig und teuer.
Arzthelfer arbeiten umsonst um Leben zu retten
Auch ich verzichte auf Lohnausfall, Spritkosten und Co. Helfen ist eine Selbstverständlichkeit und muss nicht belohnt werden. So ist zumindest meine Herangehensweise an das Ganze. Das abgenommene Blut kommt in einem Karton, den ich einfach in den Briefkasten werfen kann. Ab hier kann es unterschiedlich lang dauern, bis eine Rückmeldung kommt. Ein anderer Spender
berichtet davon, dass er 7 Wochen auf eine Nachricht gewartet hat. Ich erhalte meine Nachricht allerdings schon nach wenigen Tagen – Ich kann Spender werden. Dabei geht die DKMS immer schnell vor auf dem Informationsweg. Ich bekomme eine E-Mail, einen Anruf und auch eine SMS. Damit jede Info auch wirklich bei mir ankommt. Ich werde in eine spezielle Blutentnahmeklinik in Frankfurt gebeten, in der ich ungefähr einen halben Tag untersucht werde.
Wo es für mich räumlich am günstigsten ist, kann ich mir aussuchen beziehungsweise als Wunsch äußern, der Bedarf des Patienten und der Zeit geht allerdings vor. Die Voruntersuchung ist bereit eine knappe Woche später, aber man geht stets auf meine Terminbedürfnisse ein. Mit der Spende zum Beispiel: Ich fliege im Oktober in die USA und teile das auch mit und so wird dieser Zeitraum ausgeschlossen. Wobei ich auch meine Bereitschaft äußere, diesen Flug zu stornieren. Das Leben eines anderen Menschen geht vor. Aber auch das ist kein Problem, man versucht alles es zeitlich passend zu halten und so kann ich Ende September spenden.
Genaue Untersuchungen bevor gespendet wird
Bei der Voruntersuchung muss ich Fragebögen ausfüllen, wie man das vom Arzt schon kennt. Mir wird erneut Blut und auch Urin abgenommen und meine Milz wird per Ultraschall untersucht. Dabei checkt der Arzt auch noch den Rest meines Körpers. Ich weiß also jetzt, dass ich zumindest im Oberkörper recht gesund bin. Im Laufe der Vorbereitungen zur Spende wird meine Milz anschwellen, deshalb ist diese Untersuchung wichtig. Aber dazu später mehr. Die Laborergebnisse bekomme ich einige Tage später per Post und die sind umfangreich.
Neben den üblichen Standardwerten wurde untersucht auf Toxoplasmose, Herpes-Viren und viele andere Krankheiten. Denn der Empfänger wird aus meinen Zellen neues Knochenmark bilden und ein extrem schwaches Immunsystem haben. Daher könnten bestimmte Vorerkrankungen die Patienten gefährden. Aber ich bin immer noch spendetauglich. Das freut mich. Ab hier wird es ernst. Richtig ernst. Denn: Wir machen den eigentlichen Spendertermin aus. Ungefähr 10 Tage vor meiner Spende wird aber beim Empfänger damit begonnen, sein Knochenmark zu zerstören.
Damit er von mir neues bekommen kann. Wenn ich in diesen 10 Tagen einen Rückzieher mache, mir etwas passiert oder etwas das Verfahren verzögert, bedeutet das mit fast 100% Sicherheit den Tod des Empfängers. Das macht man mir sehr deutlich klar. Für mich steht das nie in Zweifel, aber man muss sich halt bewusst sein, dass es für mich nur ein paar Nadelpeikser sind. Für die empfangende Person ist es aber Hoffnung. Oft die letzte und einzige. Ich verdrücke mir eine Träne, dass ist schon eine emotionale Last. Aber mir hilft der Gedanke, dass es jemand anderen schlecht geht und es jede Sekunde wert ist. Egal ob es schmerzhaft, anstrengend oder „gefährlich“ aufgrund möglicher Nebenwirkungen wird. Es könnte auch mein 3- jähriger Sohn sein. Oder meine Frau. Oder ich. Krebs kennt keine Altersgrenze und ist immer ein Schicksal.
Ich mache einen letzten Coronatest ungefähr zwei Wochen vor dem Spendetermin und sende ihn per Post ins Spendezentrum. Auch hier ein negatives Ergebnis, ab jetzt kommt der
„unangenehme“ Teil: Stammzellen befinden sich im Knochenmark. Da müssen sie aber raus. Früher wurde dazu aus dem Beckenkamm Knochenmark entnommen und auch heute ist das manchmal noch nötig. Ein kleiner Eingriff, aber ein Eingriff. Anfang der 90er entdeckte man allerdings ein Verfahren, um Stammzellen aus dem Blut zu entnehmen.
Man fand heraus: Im Rahmen einer Erkrankung werden vermehrt Leukozyten gebildet, die weißen Blutkörperchen. Der Vorgänger dieser Zellen befindet sich im Knochenmark, wird dann erst zur Leukozyte und wandert ins Blut. Aber auch einige Zellen ohne „fertige Funktion“ gelangen dabei in den Kreislauf, sie können quasi alles werden was sie wollen. Und genau das sind die Stammzellen. Um diesen Prozess künstlich zu provozieren, hat man das körpereigene Hormon G-CSF als geeignet ausgemacht. Über einige Tage in höheren Dosen verabreicht, erzeugt es beim Körper das Bedürfnis Leukozyten herzustellen. Und das tut er dann auch fleißig.
Durch die Gabe von G-CSF erhöht sich die Anzahl der weißen Blutkörperchen in kurzer Zeit auf um das 3-10fache. Und somit eben auch die Anzahl der freien Stammzellen im Blut. Das Hormon muss allerdings gespritzt werden. Zweimal täglich. Damit man nicht ständig zu Unzeiten einen Arzt dafür finden muss, wird es zur Selbstanwendung mitgegeben. Für jeden Tag erhält man zwei Pakete mit einer Spritze und der vorzubereitenden Lösung. Das ganze spritzt man sich dann selbst wie man es von einer Thrombosevorbeugung oder Insulinspritze kennt in Bauch oder Oberschenkel. Kurze Nadel, kaum spürbar und nicht nennenswert.
Aber es gibt Nebenwirkungen, und die bekommt man sehr wahrscheinlich: Knochen- und Gliederschmerzen gibt es häufig und auch ich spüre es. Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Muskelkater, kaum mehr. Die Milz vergrößert sich und tatsächlich spüre ich meine Milz. Dieses Organ lebte bis dato eher unauffällig in meinem Körper, aber jetzt kann ich es fühlen. Oder bilde es mir zumindest ein. Die Vergrößerung bedeutet jedoch auch die Gefahr eines Risses der Milz bei Kraftanstrengung oder heftigen Erschütterungen. Von Kraftsport und Boxen wird mir dringend abgeraten. Und das sollte man auch ernst nehmen. Die Hebebegrenzung von 10 Kilo ist allerdings mit einem 3jährigen schwer umsetzbar. Aber ich habe überlebt, es ging also. Ein bisschen Vorsicht lässt man aber dann doch besser walten. Diese Nebenwirkung waren problemlos ertragbar, man erhält auch Schmerzmittel für den Fall das man sie benötigt und kann sich auch jederzeit krankschreiben lassen. Beides ist bei mir nicht notwendig.
Einzig am Tag vor der Spende teilt mir mein Körper beim Arbeiten durch Herzrasen mit, dass ich nach vier Tagen spritzen etwas kürzer treten soll. Das kommt mir aber recht, den am nächsten Tag heißt es früh aufstehen um morgens im Spendezentrum anzukommen. Man sollte seine gesamte Morgentoilette erledigt haben, denn aufstehen während der Spende ist nicht möglich. Man bekommt ein bequemes Bett zugewiesen und muss dann beide Arme hergeben. In einem Arm wird das Blut entnommen, in eine Maschine geführt und von den Stammzellen befreit. Der Rest Blut kommt wieder zurück durch einen normalen Venenkatheter. Auf der Entnahmeseite muss allerdings eine größere Nadel im Arm verbleiben. Diesen darf man während der 3-5 Stunden dauernden Prozedur auch nicht bewegen. Das und die Tatsache, dass ich nach 3 Stunden Blasendruck verspüre, sind allerdings die größten Probleme und gerade mit Blick auf das Empfängerleid sehr leicht erträglich. Solidarität heißt eben auch mal Unbequemlichkeit, da kann jeder mal durch. Ich werde durchgehend gut betreut, alle sind unfassbar freundlich und gut gelaunt, eine Wohltat in unserem überlasteten Medizinsystem. Wir sind vier Spender unterschiedlicher Altersgruppen. Keiner von uns hat größere Nebenwirkungen.
Einzig durch einen Wirkstoff an der Nadel, der verhindert, dass die Nadel verstopft, wird Calcium im Körper abgebaut. Das führt zu kribbeln und kann auch zu Muskelkrämpfen führen. Als das Kribbeln bei mir einsetzt, nach ungefähr zehn Minuten, beobachte ich diese Entwicklung genau. Es beginnt in den Fingerspitzen und ich bin mir nicht sicher ob es am steifen Arm liegt. Als aber meine Lippen kribbeln und meine Zähne sich stumpf anfühlen, sage ich dann doch dem Personal bescheid. Ich will keinen Krampf im Arm riskieren während da eine Nadel drinnen steckt. Das Personal hängt aber einfach einen Beutel Calcium-Infusion an meinen Arm und sofort verschwindet das Gefühl. Ich höre ein Hörbuch, unterhalte mich mit dem Personal und nicke auch nochmal kurz ein. Wann die Spende beendet ist, wird zu Beginn berechnet. Als ich nach drei Stunden also wirklich dringend pinkeln muss, entschließe ich mich, die letzte halbe Stunde durchzuhalten um nicht im Liegen in eine Flasche zu urinieren.
Das wäre jederzeit möglich, auch ein großes Geschäft ist machbar, aber man muss dem Personal und sich selbst das Leben ja nicht schwer machen. Der stillgelegte Arm ist nach dieser Zeit auch etwas steif und unangenehm, aber ich hatte deutlich schlimmere Tage im Leben, also einfach kurz wegatmen und die letzte halbe Stunde abwarten. Nachdem ich und der Apparat wieder von einander getrennt sind, kann ich auch sofort aufstehen. Anders als bei der Blutspende verliert man kaum Blut im Kreislauf und keiner von uns hatte daher Probleme mit Schwindel oder ähnlichem. Es ist ein bisschen kühl, da das zurückerhaltene Blut nicht extra erwärmt wird, aber auch das ist verkraftbar und durch warme Kleidung und eine Decke die man erhält ausgleichbar.
Ich muss noch eine halbe Stunde auf die Ergebnisse warten um sicherzustellen, dass die Zellenanzahl ausreichend war und werde auch hier nochmal mit leckerem Essen und Getränken versorgt. Dann kann ich gehen. Ich habe hoffentlich jemand anderen das Leben geschenkt oder zumindest Hoffnung. Ein emotionaler Moment, der wirklich glücklich macht. Egal ob Kind oder Greis, Schwarz oder weiß: Wenn mich jemand fragt, was ein Leben wert ist, kann ich jetzt immer sagen: Mindestens ein bisschen Blut und Zeit. Eigentlich kein hoher Einsatz.
Trotzdem sind weltweit nicht genug Menschen registriert. Alle 12 Minuten erfährt in Deutschland jemand das er Blutkrebs hat. Oftmals Kinder. Und jeder zehnte Erkrankte findet einem Artikel des Ärzteblatts nach keinen Spender. Zumindest ich finde das zuviel. Jeder sollte einen Spender finden können, jeder der kann sollte sich typisieren lassen. Es ist kostenlos, unaufwendig und einfach. Bis zum 61. Lebensjahr kann man bei der DKMS spenden. Es gibt einige Ausschlusserkrankungen, aber das findet man alles im Rahmen der Typisierung heraus.
Ich empfehle im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements in Firmen gerne, die DKMS einzuladen oder Sets zur Typisierung zu besorgen. Egal ob DKMS oder einer der anderen Anbieter zur Typisierung: Es ist für alle eine Herzenssache und man sollte jeden immer wieder darauf stoßen sich anzumelden. Mundabstrich machen, wegschicken, fertig. Haben wir während der Coronakrise alle tausend Mal gemacht, einmal mehr sollte kein Thema sein. Leben retten kann so einfach sein, daher meine persönliche Bitte an Sie: Lassen Sie sich typisieren. Seien Sie für einen Sohn, eine Mutter oder einen Opa eine letzte Hoffnung. Es lohnt sich. Versprochen. (Autor und Fotos: Kenny Kirstges)
Gesundheit
„Ich stehe allein da“: Patient verzweifelt nach Schließung des MVZ Galeria Med in Nastätten Leser schildert seine vergebliche Suche nach der eigenen Patientenakte

NASTÄTTEN Nachdem das Medizinische Versorgungszentrum Galeria Med in Nastätten zum 1. Oktober seine Türen geschlossen hat, beginnt für viele ehemalige Patienten ein Spießrutenlauf. Während die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) den Wegfall der Praxis mit einem mobilen Arztmobil zu überbrücken versucht, bleiben viele Betroffene ohne Zugang zu ihren medizinischen Unterlagen – und damit ohne wichtige Informationen für ihre weitere Behandlung.
Wie schwierig die Lage tatsächlich ist, zeigt ein Schreiben eines Bürgers aus der Verbandsgemeinde Nastätten, der sich hilfesuchend an den BEN Kurier gewandt hat. Er fühlt sich im Stich gelassen, von allen Seiten.
»Die neue Praxis, die mich übernehmen möchte, benötigt meine Patientenakte. Doch niemand kann mir sagen, wo sie ist oder wie ich sie bekomme«, schildert der Mann seine Erfahrung. »Die KV konnte mir telefonisch nicht helfen, der Insolvenzverwalter ist im Urlaub, und das verbliebene Personal weiß von nichts. Ich solle mich gedulden.«
Auch die elektronische Patientenakte (e-PA), die eigentlich eine digitale Lösung bieten soll, hilft ihm nicht weiter. „In meiner neuen Praxis funktioniert das System noch nicht„, so der Betroffene. „Man hätte mir mit der E-Mail des Insolvenzverwalters weiterhelfen können, aber die hatte ich schon, ohne zu wissen, dass es sich um den Insolvenzverwalter handelt.„
Nach Informationen des BEN Kuriers ist die rechtliche Lage kompliziert: Bei einer Praxisinsolvenz geht das Eigentum an den Patientenakten grundsätzlich an den Insolvenzverwalter über, der für deren sichere Verwahrung und spätere Herausgabe zuständig ist. Doch die Kommunikation zwischen Verwalter, KV und Nachfolgepraxen scheint in diesem Fall nicht immer zu funktionieren.
Verzweifelt wandte sich der Patient erneut direkt an die KV, doch auch dort stieß er auf eine Mauer der Zuständigkeiten. »Die KV erklärte mir, sie könne nichts tun. Der Insolvenzverwalter sei zuständig, aber der war nicht erreichbar. Ich habe mehrfach angerufen, doch niemand wusste etwas.« Weiter monierte der Bürger die öffentliche Kommunikation der Praxis und der jetzigen Verantwortlichen: »In der Amtsblattausgabe Blaues Ländchen aktuell vom 8. Oktober steht, man solle sich telefonisch an die Praxis oder an die KV wenden. Aber die Praxis ist längst geschlossen, und die KV verweist auf fehlende Möglichkeiten. Wie soll das gehen?«
Inzwischen hat er zwar einen Termin im Arztmobil der KV erhalten, doch die Skepsis bleibt: »Ich bin gespannt, wie das funktionieren soll, wenn man dort keine Einsicht in meine bisherigen Befunde hat. So kann doch keine durchgehende Behandlung stattfinden.«
Sein Fazit fällt ernüchternd aus: „Es ist traurig, dass man als Patient nach so einer Insolvenz völlig auf sich allein gestellt bleibt. Ein bisschen mehr Verantwortung, Organisation und Transparenz wäre wünschenswert – für alle, die einfach nur ärztliche Hilfe brauchen.“ Der Fall zeigt beispielhaft, wie schwierig die Situation für viele Betroffene derzeit ist.
Während die Praxis geschlossen und die Abläufe ungeklärt sind, bleibt für die Patienten vorerst nur die Hoffnung, dass sich bald eine Lösung für den Zugang zu ihren Unterlagen findet.
Gesundheit
Hospizdienste Rhein-Lahn: Mit trauernden Kindern im Schmetterlingspark in Bendorf

NASSAU|BENDORF „Kinder trauern anders“, weiß Petra Opel-Minor von den Ambulanten Hospizdiensten Rhein-Lahn. Zusammen mit Gabi Maas rief sie vor gut einem Jahr die Kindertrauergruppe TrauKidsKatz ins Leben. Diese trifft sich alle vierzehn Tage im Haus der Familie in Katzenelnbogen. Jetzt unternahmen die Kinder zusammen mit ihren Begleiterinnen einen Ausflug in den Schmetterlingspark in Bendorf-Sayn.
Kinder von TrauKidsKatz unternahmen einen Ausflug nach Bendorf-Sayn
Bei den Zusammenkünften mittwochs im Haus der Familie haben die Kinder zwei Stunden Gelegenheit, kreativ zu werden, zu gestalten, sich auszutauschen oder einfach zu spielen. Es ist eine geschützte Atmosphäre. Die Trauerbegleiterinnen hören zu, geben Impulse und lassen den Kindern vor allem Raum, ihren eigenen Weg zu finden. Die Kinder erleben, dass sie nicht alleine sind. Die Familiengestützte Trauerarbeit ist eine Form der Begleitung, die darauf abzielt, Familien als Ganzes zu unterstützen, den Verlust eines geliebten Menschen zu verarbeiten.
Vom Ausflug nach Bendorf-Sayn berichtet Gabi Maas: „Wir waren mit neun Kindern der TrauKidsKatz und fünf Betreuerinnen auf eine kleine Reise gewesen. Die Reise ging um 10.00 Uhr in Katzenelbogen los in der Schmetterlings Park nach Bendorf-Sayn. Bei schönem Wetter konnte die erste Station des Tages auf dem Spielplatz stattfinden und es wurde ausgiebig geklettert, geschaukelt und rumgealbert und Petra hat für uns alle ein wunderbares Picknick vorbereitet. Es war sehr lecker.
Frisch gestärkt durften wir einer netten Dame lauschen, die uns alles von der Eiablage bis zum Schmetterling erklärt hat. Die Kids haben super toll mitgemacht, Fragen gestellt und eine Stunde ruhig gesessen und zugehört. Das war für unsere kleinen Wirbelwinde schon eine ganz tolle Leistung.
Danach durften wir alle die Schmetterlinge live erleben. Die Kinder und wir sind kreuz und quer durch den Schmetterlingspark. Einige haben sogar versucht, ganz wie versteinert da zu sitzen, in der Hoffnung, dass ein Schmetterling sich auf sie setzt.
Fasziniert von den Schmetterlingen
Es war so ein wunderschöner Tag für uns alle. Nochmal schnell eine Runde Bewegung auf dem Spielplatz und dann ging es auch schon wieder mit dem Bus nach Katzenelbogen zurück. Als Abschluss gab es für jeden noch ein Eis in der Eisdiele und Schmetterlings-Geschenke, die alle an den schönen Tag erinnern sollen. Ein großes Dankeschön für die Handarbeiten an die liebe Steffy Scheer-Kuehchen, die extra für unsere Kinder der TrauKidsKatz häkelt.
Dieser Tag hat unser aller Herz mit so viel Liebe gefüllt. Petra und ich sind dafür unendlich dankbar. Ein Herzliches Dankeschön an unsere Unterstützer. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Einen besonderen Dank auch an die Mama und Oma von Marlon und Emmie und an Claudia Brandstaedter, dass ihr an diesem Tag dabei wart und uns unterstützt habt.
Es ist so schön, in glückliche Kinderaugen zu schauen. Ihr alle habt diesen Tag zu etwas Besonderem gemacht, Ich hoffe und wünsche mir, dass wir noch viele Möglichkeiten finden, die TrauKidsKatz Projekte in dieser Form umzusetzen und den Kindern eine schöne Zeit zu schenken. Bitte erzählt von dem Projekt TrauKidsKatz und der Kinder Trauer es betrifft so viele Familien. Wir brauchen auch in der Zukunft Förderer jeder Art, auch finanziell natürlich.“ (cv)
Gesundheit
LandarztPlus: Neue Praxis in Welschneudorf eröffnet und gesegnet

WELSCHNEUDORF Das Konzept „LandarztPlus“ wächst weiter: Nach der erfolgreichen Übernahme einer Hausarztpraxis in Welschneudorf zu Jahresbeginn hat die Praxis nun ihre neuen Räume im ehemaligen „Westerwälder Hof“ bezogen. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde mit Vertretern der BBT-Gruppe, der Verbandsgemeinde Montabaur, den Praxisteams aus Montabaur und Welschneudorf sowie der Bauherren von der „Westerwälder Hof Welschneudorf eGbR“ wurden die Räumlichkeiten offiziell eröffnet und von Krankenhausseelsorger Thomas Müller und Pfarrer Steffen Henrich (Pfarrei St. Peter Montabaur) eingesegnet.
Die LandarztPlus-Praxis ist ein Gemeinschaftsprojekt der BBT-Gruppe – zu der auch das Katholische Klinikum Koblenz Montabaur gehört – und der Verbandsgemeinde Montabaur. Ziel ist es, die hausärztliche Versorgung in Stadt und Land nachhaltig zu sichern und weiterzuentwickeln und damit die Region als attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort zu stärken.“
„Das ganz große Plus ist, dass es weitergeht“ – Platz für neue Patienten
Christian Hartz, der die Hausarztpraxis in Welschneudorf seit 1992 prägt und weiterhin Teil des Ärzteteams ist, zeigte sich begeistert: „Räumlich und qualitativ ist das ein absoluter Gewinn – es ist wunderschön geworden. Das ganz große Plus ist aber, dass es weitergeht. Mit den neuen Räumlichkeiten sind wir barrierefrei und bestens für die Zukunft aufgestellt.“ In der neuen LandarztPlus-Praxis in Welschneudorf können sich auch neue Patienten anmelden. Christian Hartz wird von der Ärztin Camilla Maria Cabrera Aguilera unterstützt, die bereits seit dem 1. Mai 2025 zum Team gehört.
Versorgung vor Ort erhalten
Ulrich Richter-Hopprich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Montabaur, hob die Bedeutung der neuen Praxis für die Region hervor:„Von Stunde eins an war es uns besonders wichtig, dass wir nicht nur eine zentrale Praxis in Montabaur betreiben, sondern bewusst auch in die Ortsgemeinden gehen, um dort Strukturen zu erhalten und die Versorgung aufrechtzuerhalten. Dass uns das in Welschneudorf so gut gelungen ist, freut mich außerordentlich. Mein Dank gilt der BBT-Gruppe für ihr Know-how und ihr Engagement, aber auch der Ortsgemeinde, den Ärzten Hartz und Wachter sowie dem gesamten Praxisteam. Sie alle haben diesen Übergang ermöglicht und tragen die gute Arbeit in die Zukunft.“ In den Dank schloss Richter-Hopprich den Wirtschaftsförderer Alexander Klinge ein, der in der Verwaltung die Zusammenarbeit mit LandarztPlus übernommen hat.
Ein Modell mit Signalwirkung
Auch Jérôme Korn-Fourcade, Regionalgeschäftsführer der BBT-Region Koblenz-Saffig, ordnete die Eröffnung in die langfristige Strategie ein: „Wir sehen den demographischen Wandel und das Ausbluten von Infrastruktur im ländlichen Raum. Mit LandarztPlus wollen wir dem strukturiert entgegenwirken – und das funktioniert hier in Welschneudorf vom ersten Tag an hervorragend. Als christlicher Träger stehen wir für mehr als reines Business: Wir kommen aus der Region und gestalten mit Partnern wie der Verbandsgemeinde Versorgung für die Menschen hier vor Ort. Dass die Praxis in so schönen Räumlichkeiten neu starten kann, macht diesen Tag für uns zu etwas ganz Besonderem.“
Modell für die Region
Die neuen Räume bieten moderne medizinische Ausstattung, Barrierefreiheit und Platz für die Weiterentwicklung des Praxisteams. Das Konzept LandarztPlus setzt dabei bewusst auf Teamarbeit, Telemedizin und die Integration jüngerer Ärztinnen und Ärzte, die von der Erfahrung langjähriger Kolleginnen und Kollegen profitieren können. Mit der Eröffnung der neuen Praxis in Welschneudorf ist ein weiterer wichtiger Baustein für die medizinische Versorgung im Westerwald gelegt – mitten im Dorf und mit klarer Perspektive für die Zukunft.
Der Westerwälder Hof
Die ehemalige Gaststätte „Westerwälder Hof“ wird derzeit zu einem kombinierten Wohn- und Geschäftshaus umgebaut. Die privaten Investoren Guido und Leon Fries sowie Martin Schmidt haben das Gebäude erworben und die „Westerwälder Hof Welschneudorf eGbR“ gegründet. Nach Plänen des Büros Fries Architekten entstehen in dem Komplex neben den Räumen für die Landarzt Plus-Praxis und einem Backshop mit Café (Ninks Backstube) insgesamt 26 barrierefreie Wohnungen nach KfW-40-EE-Standard. Das Projekt wird durch die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) gefördert. Es entsteht bezahlbarer Wohnraum für Personen, die einen Wohnberechtigungsschein haben.
Kontakt
LandarztPlus Praxis Welschneudorf
Bad Emser Straße 1, 56412 Welschneudorf
Telefon: 02608 331, Fax: 02608 507
E-Mail: LandarztPlus-Welschneudorf@bbtgruppe.de
Öffnungszeiten
Montags: 8 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr
Dienstags: 8 bis 13 Uhr
Mittwochs: 8 bis 13 Uhr
Donnerstags: 8 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr
Freitags: 8 bis 13 Uhr
Parkmöglichkeiten
In der Dorfmitte stehen bei der Kurfürstenhalle (Lindenweg) ausreichend öffentliche Parkplätze zur Verfügung.
-

 Allgemeinvor 3 Jahren
Allgemeinvor 3 JahrenRhein-Lahn-Kreis feiert 1. Mai – Wir waren in Dornholzhausen, Nievern, Hirschberg und Fachbach – Video im Beitrag
-

 VG Loreleyvor 4 Jahren
VG Loreleyvor 4 JahrenVG Loreley bietet Sommerfreizeit für Kinder aus den Flutgebieten
-

 Schulenvor 4 Jahren
Schulenvor 4 JahrenVG Bad Ems-Nassau investiert in die Sanierung der Turnhalle der Freiherr-vom-Stein Schule Bad Ems
-

 Koblenzvor 4 Jahren
Koblenzvor 4 JahrenKoblenz beschließt neue Baumschutzsatzung
-

 Blaulichtvor 4 Wochen
Blaulichtvor 4 WochenMillionenschäden bei Glasfaserausbau: Subunternehmer aus dem Rhein-Lahn-Kreis warten auf Gelder von Phoenix Engineering
-

 Koblenzvor 5 Monaten
Koblenzvor 5 MonatenKoblenz ausgebremst: Geplante Zug-Offensive scheitert an Bauchaos
-

 VG Nastättenvor 4 Jahren
VG Nastättenvor 4 JahrenAus für Endlichhofmilch? Zellmanns Birkenhof in Endlichhofen meldet Insolvenz an!
-

 VG Nastättenvor 1 Jahr
VG Nastättenvor 1 JahrLandwirt hat Tiere nicht im Griff: Kühe brechen immer wieder auf den Segelflugplatz Nastätten aus