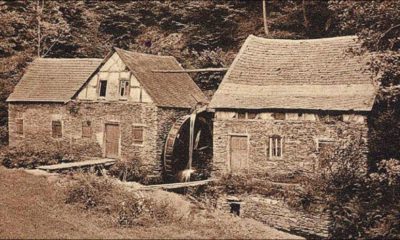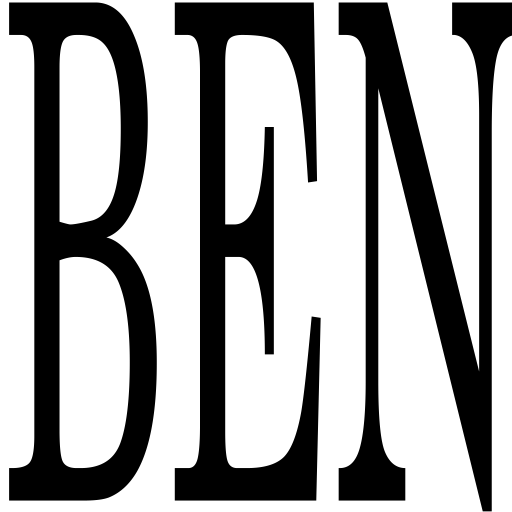Gesundheit
Kenny spendet Knochenmark – Leben retten kann so einfach sein! – Eine interessante Geschichte aus dem Rhein-Lahn-Kreis
 Zubereitungsset Hormonpräparat G-CSF
Zubereitungsset Hormonpräparat G-CSF
RHEIN-LAHN Es ist ein Donnerstagnachmittag und ich lege gerade meinen Sohn zum Mittagsschlaf, als wir einen Anruf bekommen. Irgendjemand von der DKMS wolle etwas von mir, teilt mir meine Frau mit. Die DKMS ist die Deutsche Knochenmarksspenderdatei. Diese Organisation ist eine von ungefähr 30 in Deutschland, die sich um die Knochenmarksspende kümmert, einem Verfahren das in den 1960er-Jahren entwickelt wurde um Krankheiten wie Leukämie, im Volksmund als Blutkrebs bekannt, sowie andere schwere Erkrankungen zu behandeln. Bis Ende der 1980er Jahre bedeutete die Diagnose und Behandlung Blutkrebs in vielen Fällen den Tod, da die Nebenwirkungen schwer in den Griff zu bekommen waren und das Verfahren kompliziert war.
Aber das hat sich geändert. Auch dank der DKMS. Überrascht gehe ich ran, jahrelang hatte ich die Spenderkarte im Portmonee und habe sonst keinen Gedanken daran verschwendet. Es ist fast zwanzig Jahre her, dass ich mich als Spender registriert habe. Als junger Soldat waren Dinge wie Blutspende, Typisierung und andere solidarische Möglichkeiten für mich und meine Kameraden selbstverständlich. Vor einigen Jahren habe ich das letzte Mal an die DKMS im Rahmen eines Umzugs gedacht und meine Daten aktualisiert. Denn der Datenschutz wiegt schwer bei der DKMS und wenn jemand unbekannt verzieht ist es quasi unmöglich für die Mitarbeiter den- oder diejenige ausfindig zu machen.
Das Problem dabei: Für die Spende benötigt man jemanden, der sehr viele spezielle genetische Merkmale mit dem Empfänger teilt, so ein bisschen vorstellbar wie bei einem Zwilling. Bei mehr als 20.000 verschiedenen Genen ist die Chance auf eine Übereinstimmung also gering. Und wenn derjenige, der passen würde registriert und unbekannt verzogen ist, ist das für die Mitarbeiter frustrierend. Denn dahinter stehen Schicksale, Schmerz und Leid und eben dann in vielen Fällen auch der Tod. Daher sollten auch bereits registrierte Personen ihre Daten regelmäßig abgleichen.
Ich führe mit der Frau von der DKMS ein ungefähr 15-minütiges Telefonat. Dabei gleicht sie Gesundheitsdaten ab, stellt mir einige medizinische Fragen nach meiner Konstitution und klärt
mich über den Ablauf des Verfahrens auf. Klar wird direkt eines: Die Ernsthaftigkeit des Verfahrens. Meine bisher gesammelten Daten ergeben die Möglichkeit, dass ich als Spender in
Frage käme. Ob das aber so ist muss in weitergehenden Untersuchungen geklärt werden. Der Patient erfährt über diese Suche und ihren Erfolg bzw. Misserfolg erstmal nichts, da die emotionale Belastung immens wäre und die Suche aufwendig ist. Denn gespendet und gesucht wird weltweit und nicht nur auf Deutschland begrenzt. Alles anonymisiert, auch die Mitarbeiter der DKMS wissen nur das nötigste.

Zubereitungsset Hormonpräparat G-CSF
Innerhalb eines Tages bekomme ich ein kleines Päckchen zugesendet mit Infomaterial, Briefen für meinen Hausarzt und Röhrchen für eine Blutentnahme. Beim Arzt bekomme ich sofort einen Termin für die Untersuchung, man nimmt mich dazwischen und behandelt mich gut. Jedem Beteiligten ist klar, dass es um Zeit, Leben und Tod geht. Die entstehenden Kosten übernimmt dabei komplett und unbürokratisch die DKMS. Wobei die Arzthelferin, welche mir Blut abnimmt mir mitteilt, dass sie das umsonst machen und nicht abrechnen. Denn die Arbeit der DKMS ist gemeinnützig, es geht nicht um Profite und die Prozesse sind aufwendig und teuer.
Arzthelfer arbeiten umsonst um Leben zu retten
Auch ich verzichte auf Lohnausfall, Spritkosten und Co. Helfen ist eine Selbstverständlichkeit und muss nicht belohnt werden. So ist zumindest meine Herangehensweise an das Ganze. Das abgenommene Blut kommt in einem Karton, den ich einfach in den Briefkasten werfen kann. Ab hier kann es unterschiedlich lang dauern, bis eine Rückmeldung kommt. Ein anderer Spender
berichtet davon, dass er 7 Wochen auf eine Nachricht gewartet hat. Ich erhalte meine Nachricht allerdings schon nach wenigen Tagen – Ich kann Spender werden. Dabei geht die DKMS immer schnell vor auf dem Informationsweg. Ich bekomme eine E-Mail, einen Anruf und auch eine SMS. Damit jede Info auch wirklich bei mir ankommt. Ich werde in eine spezielle Blutentnahmeklinik in Frankfurt gebeten, in der ich ungefähr einen halben Tag untersucht werde.
Wo es für mich räumlich am günstigsten ist, kann ich mir aussuchen beziehungsweise als Wunsch äußern, der Bedarf des Patienten und der Zeit geht allerdings vor. Die Voruntersuchung ist bereit eine knappe Woche später, aber man geht stets auf meine Terminbedürfnisse ein. Mit der Spende zum Beispiel: Ich fliege im Oktober in die USA und teile das auch mit und so wird dieser Zeitraum ausgeschlossen. Wobei ich auch meine Bereitschaft äußere, diesen Flug zu stornieren. Das Leben eines anderen Menschen geht vor. Aber auch das ist kein Problem, man versucht alles es zeitlich passend zu halten und so kann ich Ende September spenden.
Genaue Untersuchungen bevor gespendet wird
Bei der Voruntersuchung muss ich Fragebögen ausfüllen, wie man das vom Arzt schon kennt. Mir wird erneut Blut und auch Urin abgenommen und meine Milz wird per Ultraschall untersucht. Dabei checkt der Arzt auch noch den Rest meines Körpers. Ich weiß also jetzt, dass ich zumindest im Oberkörper recht gesund bin. Im Laufe der Vorbereitungen zur Spende wird meine Milz anschwellen, deshalb ist diese Untersuchung wichtig. Aber dazu später mehr. Die Laborergebnisse bekomme ich einige Tage später per Post und die sind umfangreich.
Neben den üblichen Standardwerten wurde untersucht auf Toxoplasmose, Herpes-Viren und viele andere Krankheiten. Denn der Empfänger wird aus meinen Zellen neues Knochenmark bilden und ein extrem schwaches Immunsystem haben. Daher könnten bestimmte Vorerkrankungen die Patienten gefährden. Aber ich bin immer noch spendetauglich. Das freut mich. Ab hier wird es ernst. Richtig ernst. Denn: Wir machen den eigentlichen Spendertermin aus. Ungefähr 10 Tage vor meiner Spende wird aber beim Empfänger damit begonnen, sein Knochenmark zu zerstören.
Damit er von mir neues bekommen kann. Wenn ich in diesen 10 Tagen einen Rückzieher mache, mir etwas passiert oder etwas das Verfahren verzögert, bedeutet das mit fast 100% Sicherheit den Tod des Empfängers. Das macht man mir sehr deutlich klar. Für mich steht das nie in Zweifel, aber man muss sich halt bewusst sein, dass es für mich nur ein paar Nadelpeikser sind. Für die empfangende Person ist es aber Hoffnung. Oft die letzte und einzige. Ich verdrücke mir eine Träne, dass ist schon eine emotionale Last. Aber mir hilft der Gedanke, dass es jemand anderen schlecht geht und es jede Sekunde wert ist. Egal ob es schmerzhaft, anstrengend oder „gefährlich“ aufgrund möglicher Nebenwirkungen wird. Es könnte auch mein 3- jähriger Sohn sein. Oder meine Frau. Oder ich. Krebs kennt keine Altersgrenze und ist immer ein Schicksal.
Ich mache einen letzten Coronatest ungefähr zwei Wochen vor dem Spendetermin und sende ihn per Post ins Spendezentrum. Auch hier ein negatives Ergebnis, ab jetzt kommt der
„unangenehme“ Teil: Stammzellen befinden sich im Knochenmark. Da müssen sie aber raus. Früher wurde dazu aus dem Beckenkamm Knochenmark entnommen und auch heute ist das manchmal noch nötig. Ein kleiner Eingriff, aber ein Eingriff. Anfang der 90er entdeckte man allerdings ein Verfahren, um Stammzellen aus dem Blut zu entnehmen.
Man fand heraus: Im Rahmen einer Erkrankung werden vermehrt Leukozyten gebildet, die weißen Blutkörperchen. Der Vorgänger dieser Zellen befindet sich im Knochenmark, wird dann erst zur Leukozyte und wandert ins Blut. Aber auch einige Zellen ohne „fertige Funktion“ gelangen dabei in den Kreislauf, sie können quasi alles werden was sie wollen. Und genau das sind die Stammzellen. Um diesen Prozess künstlich zu provozieren, hat man das körpereigene Hormon G-CSF als geeignet ausgemacht. Über einige Tage in höheren Dosen verabreicht, erzeugt es beim Körper das Bedürfnis Leukozyten herzustellen. Und das tut er dann auch fleißig.
Durch die Gabe von G-CSF erhöht sich die Anzahl der weißen Blutkörperchen in kurzer Zeit auf um das 3-10fache. Und somit eben auch die Anzahl der freien Stammzellen im Blut. Das Hormon muss allerdings gespritzt werden. Zweimal täglich. Damit man nicht ständig zu Unzeiten einen Arzt dafür finden muss, wird es zur Selbstanwendung mitgegeben. Für jeden Tag erhält man zwei Pakete mit einer Spritze und der vorzubereitenden Lösung. Das ganze spritzt man sich dann selbst wie man es von einer Thrombosevorbeugung oder Insulinspritze kennt in Bauch oder Oberschenkel. Kurze Nadel, kaum spürbar und nicht nennenswert.
Aber es gibt Nebenwirkungen, und die bekommt man sehr wahrscheinlich: Knochen- und Gliederschmerzen gibt es häufig und auch ich spüre es. Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Muskelkater, kaum mehr. Die Milz vergrößert sich und tatsächlich spüre ich meine Milz. Dieses Organ lebte bis dato eher unauffällig in meinem Körper, aber jetzt kann ich es fühlen. Oder bilde es mir zumindest ein. Die Vergrößerung bedeutet jedoch auch die Gefahr eines Risses der Milz bei Kraftanstrengung oder heftigen Erschütterungen. Von Kraftsport und Boxen wird mir dringend abgeraten. Und das sollte man auch ernst nehmen. Die Hebebegrenzung von 10 Kilo ist allerdings mit einem 3jährigen schwer umsetzbar. Aber ich habe überlebt, es ging also. Ein bisschen Vorsicht lässt man aber dann doch besser walten. Diese Nebenwirkung waren problemlos ertragbar, man erhält auch Schmerzmittel für den Fall das man sie benötigt und kann sich auch jederzeit krankschreiben lassen. Beides ist bei mir nicht notwendig.
Einzig am Tag vor der Spende teilt mir mein Körper beim Arbeiten durch Herzrasen mit, dass ich nach vier Tagen spritzen etwas kürzer treten soll. Das kommt mir aber recht, den am nächsten Tag heißt es früh aufstehen um morgens im Spendezentrum anzukommen. Man sollte seine gesamte Morgentoilette erledigt haben, denn aufstehen während der Spende ist nicht möglich. Man bekommt ein bequemes Bett zugewiesen und muss dann beide Arme hergeben. In einem Arm wird das Blut entnommen, in eine Maschine geführt und von den Stammzellen befreit. Der Rest Blut kommt wieder zurück durch einen normalen Venenkatheter. Auf der Entnahmeseite muss allerdings eine größere Nadel im Arm verbleiben. Diesen darf man während der 3-5 Stunden dauernden Prozedur auch nicht bewegen. Das und die Tatsache, dass ich nach 3 Stunden Blasendruck verspüre, sind allerdings die größten Probleme und gerade mit Blick auf das Empfängerleid sehr leicht erträglich. Solidarität heißt eben auch mal Unbequemlichkeit, da kann jeder mal durch. Ich werde durchgehend gut betreut, alle sind unfassbar freundlich und gut gelaunt, eine Wohltat in unserem überlasteten Medizinsystem. Wir sind vier Spender unterschiedlicher Altersgruppen. Keiner von uns hat größere Nebenwirkungen.
Einzig durch einen Wirkstoff an der Nadel, der verhindert, dass die Nadel verstopft, wird Calcium im Körper abgebaut. Das führt zu kribbeln und kann auch zu Muskelkrämpfen führen. Als das Kribbeln bei mir einsetzt, nach ungefähr zehn Minuten, beobachte ich diese Entwicklung genau. Es beginnt in den Fingerspitzen und ich bin mir nicht sicher ob es am steifen Arm liegt. Als aber meine Lippen kribbeln und meine Zähne sich stumpf anfühlen, sage ich dann doch dem Personal bescheid. Ich will keinen Krampf im Arm riskieren während da eine Nadel drinnen steckt. Das Personal hängt aber einfach einen Beutel Calcium-Infusion an meinen Arm und sofort verschwindet das Gefühl. Ich höre ein Hörbuch, unterhalte mich mit dem Personal und nicke auch nochmal kurz ein. Wann die Spende beendet ist, wird zu Beginn berechnet. Als ich nach drei Stunden also wirklich dringend pinkeln muss, entschließe ich mich, die letzte halbe Stunde durchzuhalten um nicht im Liegen in eine Flasche zu urinieren.
Das wäre jederzeit möglich, auch ein großes Geschäft ist machbar, aber man muss dem Personal und sich selbst das Leben ja nicht schwer machen. Der stillgelegte Arm ist nach dieser Zeit auch etwas steif und unangenehm, aber ich hatte deutlich schlimmere Tage im Leben, also einfach kurz wegatmen und die letzte halbe Stunde abwarten. Nachdem ich und der Apparat wieder von einander getrennt sind, kann ich auch sofort aufstehen. Anders als bei der Blutspende verliert man kaum Blut im Kreislauf und keiner von uns hatte daher Probleme mit Schwindel oder ähnlichem. Es ist ein bisschen kühl, da das zurückerhaltene Blut nicht extra erwärmt wird, aber auch das ist verkraftbar und durch warme Kleidung und eine Decke die man erhält ausgleichbar.
Ich muss noch eine halbe Stunde auf die Ergebnisse warten um sicherzustellen, dass die Zellenanzahl ausreichend war und werde auch hier nochmal mit leckerem Essen und Getränken versorgt. Dann kann ich gehen. Ich habe hoffentlich jemand anderen das Leben geschenkt oder zumindest Hoffnung. Ein emotionaler Moment, der wirklich glücklich macht. Egal ob Kind oder Greis, Schwarz oder weiß: Wenn mich jemand fragt, was ein Leben wert ist, kann ich jetzt immer sagen: Mindestens ein bisschen Blut und Zeit. Eigentlich kein hoher Einsatz.
Trotzdem sind weltweit nicht genug Menschen registriert. Alle 12 Minuten erfährt in Deutschland jemand das er Blutkrebs hat. Oftmals Kinder. Und jeder zehnte Erkrankte findet einem Artikel des Ärzteblatts nach keinen Spender. Zumindest ich finde das zuviel. Jeder sollte einen Spender finden können, jeder der kann sollte sich typisieren lassen. Es ist kostenlos, unaufwendig und einfach. Bis zum 61. Lebensjahr kann man bei der DKMS spenden. Es gibt einige Ausschlusserkrankungen, aber das findet man alles im Rahmen der Typisierung heraus.
Ich empfehle im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements in Firmen gerne, die DKMS einzuladen oder Sets zur Typisierung zu besorgen. Egal ob DKMS oder einer der anderen Anbieter zur Typisierung: Es ist für alle eine Herzenssache und man sollte jeden immer wieder darauf stoßen sich anzumelden. Mundabstrich machen, wegschicken, fertig. Haben wir während der Coronakrise alle tausend Mal gemacht, einmal mehr sollte kein Thema sein. Leben retten kann so einfach sein, daher meine persönliche Bitte an Sie: Lassen Sie sich typisieren. Seien Sie für einen Sohn, eine Mutter oder einen Opa eine letzte Hoffnung. Es lohnt sich. Versprochen. (Autor und Fotos: Kenny Kirstges)
Gesundheit
Das Nassauer Hospiz öffnet am 1. Oktober und braucht noch viele Spenden!

NASSAU „Ich könnte ja auch selbst einmal betroffen sein, oder meine Angehörigen“, sagt die Dame während sie einen Schein in die Spendenbox steckt. In der Tat ist das G. u. I. Leifheit Hospiz für alle Bürger des Rhein-Lahn-Kreises da. Inzwischen hat der Rohbau in Nassau seine Fenster erhalten und der Innenausbau läuft auf Hochtouren. Doch, um das Projekt ans Laufen zu bekommen, sind noch viele Spenden erforderlich. Es gibt diverse Möglichkeiten, wie man sich finanziell für die gute Sache engagieren kann.
„Uns ist jeder Euro willkommen. Auch kleine Spenden helfen“, erklärt Dr. Martin Schencking, Vorsitzender des Fördervereins Stationäres Hospiz Rhein-Lahn und der Stiftung Hospiz Rhein-Lahn. In den sieben Jahren seines Bestehens hat der Verein inzwischen knapp 400.000 Euro an Spendengeldern gesammelt. Hinzu kommen Mitgliedsbeiträge und Patenschaften.
Konkret geht es jetzt um die Innenausstattung. So werden allein für die Pflegebetten und Nachttische 30.000 Euro benötigt. Zu diesem Zweck wurde gemeinsam mit der Westerwaldbank ein Crowdfunding-Projekt ins Leben gerufen. Nach Gewinnung von über 100 Fans startete am 5. April 2024 die Finanzierungsphase. Weitere Informationen unter https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/hospiz-nassau. Bei jeder Spende ab 5 Euro gibt die Westerwaldbank 10 Euro dazu. Für direkte Überweisungen: Kontoinhaber VR Payment für Viele schaffen mehr. IBAN DE 33660600000000137749, Verwendungszweck P25206 Pflegebetten für unser neues Hospiz in Nassau. Insgesamt fehlen für die Inneneinrichtung noch 300 000 Euro.
Die einfachste Art der Unterstützung ist neben einer Spende die Mitgliedschaft im Förderverein Stationäres Hospiz Rhein-Lahn für 25 oder mehr Euro pro Jahr. Außerdem kann man ab 100 Euro oder mehr eine Patenschaft übernehmen und erhält dafür eine Urkunde. Diese Form der Unterstützung ist nicht nur bei Einzelpersonen, sondern vor allem bei Firmen beliebt.
Ein Beispiel für eine solche Patenschaft ist der Pebler Rewe-Markt in Nassau. Ulrich Pebler hat eine Patenschaft über 500 Euro für sein Unternehmen übernommen und engagiert sich auch persönlich für das Projekt. So ist der 1. Beigeordnete der Stadt Nassau Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Hospiz Rhein-Lahn. Seit Anbeginn spendiert er das Wasser für die Läuferinnen und Läufer beim Nassauer Hospiz Charity Run.
Der Grund für sein Engagement? „Weil ich eine solche Einrichtung für wichtig halte und hier ein weißer Fleck im nördlichen Rheinland-Pfalz ist“. Bei Bekannten habe er erlebt, wie gut eine professionelle Sterbebegleitung ist. Im Unternehmerkreis will Ulrich Pebler um weitere Spenden für das Hospiz werben. Am 5. und 6. Juli wird er seinen Markt für einen Bücherbasar des Lions-Club Bad Ems zugunsten des Hospizes zur Verfügung stellen. Der Lions-Club unterstützt das Hospiz durchgehend von der ersten Stunde an.
Zahlreiche Privatpersonen nehmen ihren runden oder halbrunden Geburtstag zum Anlass, anstelle von Geschenken um Spenden für das Hospiz zu bitten. Ebenfalls eingebürgert hat sich das Kranzgeld, das statt Kränzen bei Beerdigungen dem Hospiz zugutekommt.
Auch für die Außenanlagen des Hospizes wird noch Geld gebraucht – rund 300 000 Euro. Hier besteht die Möglichkeit, Patenschaften zu übernehmen für den Brunnen (5000 Euro), die Pflasterung einer Sitzfläche (15.500 Euro), zwei Hochbeete, die Freiwillige anlegen (2900 Euro), Patenschaften für Himbeer- und Johannisbeersträucher (900 Euro) oder den Laubengang (8000 Euro).
Außerdem können für je ein Jahr Zimmerpatenschaften im Hospiz übernommen werden (12.000 Euro). Die Spender werden über den Zimmern und auf einer Spendertafel angezeigt. Die Zimmer in warmen Farben, verrät Dr. Schencking, werden übrigens keine Nummern erhalten, sondern Namen wie Waldzimmer, Rosenzimmer, Seerosenzimmer. Der Vorsitzende des Fördervereins wünscht sich, dass jeder Bürger des Rhein-Lahn-Kreises das Hospiz als seine Sache ansieht. Am 1. Oktober 2024 sollen die ersten Patienten, die im Hospiz Gäste genannt werden, in das neue Hospiz einziehen. Zuvor wird es einen Tag der offenen Tür geben. (vy)
 Für die Pflegebetten wurde ein Crowdfunding-Projekt ins Leben gerufen. Zu jeder Spende von 5 Euro gibt die Westerwaldbank 10 Euro hinzu. | Foto: Hanne Benz
Für die Pflegebetten wurde ein Crowdfunding-Projekt ins Leben gerufen. Zu jeder Spende von 5 Euro gibt die Westerwaldbank 10 Euro hinzu. | Foto: Hanne Benz Gesundheit
Tolle Arbeit der First Responder in Miehlen: SPD informiert sich vor Ort!

MIEHLEN Auf Einladung des SPD-Ortsvereins Miehlen trafen sich die SPD-Kandidaten aus der VG Nastätten mit Vertretern der First Responder am Standort Miehlen. Gruppenleiter Andreas Retzel und sein Stellvertreter Eric Sniehotta berichteten von der Gründung der Gruppe im Jahr 2020. Aus einer Idee von zwei Freunden hat sich eine voll funktionsfähige Einheit mit mittlerweile 16 Personen entwickelt. Die Trägerschaft der Gruppe hat das Rote Kreuz übernommen. Die Finanzierung erfolgt über die Gemeinde Miehlen und über Spenden.
Hierzu konnte die Kassiererin vom Förderverein Michelle Schwank detailliert berichten.
Im Vorfeld wird von den First Respondern eine medizinische Grundausbildung verlangt. Hinzu kommen 16 Fortbildungsstunden, die von den einzelnen Mitgliedern im Jahr zu erbringen sind. „Dies ist auch wichtig“, so Eric Sniehotta, „damit in Notfällen jeder Handgriff sitzt.“ Unter anderem sind auch Rettungssanitäter und Krankenschwestern in der Gruppe vertreten, welche natürlich schon von Berufswegen die notwendigen Kompetenzen vermitteln können.
Hinsichtlich des Einsatzortes sind die First Responder auf die Gemarkung Miehlen festgelegt. Die Alarmierung erfolgt parallel zum Rettungsdienst über die Leitstelle in Montabaur. Die First Responder können dadurch, dass sie vor Ort stationiert sind, die Zeit überbrücken bis der Rettungswagen eintrifft. Gerade durch die vergangenen Klinikschließungen kann es passieren, dass die Rettungswagen weit entfernte notfallaufnehmende Krankenhäuser anfahren müssen und somit zeitlich ausgelastet sind.
Mit der Notaufnahme im Krankenhaus in Nastätten ist für den Stadtbürgermeister Marco Ludwig eine wichtige Anlaufstelle in kürzester Zeit erreichbar. Zusammen mit den First Respondern stellt dies einen großen Vorteil im Bereich der medizinischen Versorgung dar und gibt den Bürgern Sicherheit. Nicht zu vergessen, der DRK OV Nastätten, der diese wertvolle Arbeit ebenso gewinnbringend für die Region ausübt.
Nach der Besichtigung des professionellen Lagers kamen im weiteren Gespräch spontan Ideen zur Unterstützung der Gruppe auf, so dass auch in Zukunft die Gesprächsteilnehmer den Kontakt halten wollen.
Für die SPDler ist es wichtig das Engagement der Gruppe sichtbarer zu machen und noch mehr Menschen für diese ehrenamtliche Tätigkeit zu begeistern. „Die Freiwilligen bei den First Respondern leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die Einwohner von Miehlen,“ meint Jörg Winter zum Abschluss des Treffens.
 Tolle Arbeit der First Responder in Miehlen: SPD informiert sich vor Ort! | Foto: SPD Miehlen
Tolle Arbeit der First Responder in Miehlen: SPD informiert sich vor Ort! | Foto: SPD Miehlen Gesundheit
Stadt Koblenz unterstützt mit rund 125.000 Euro Pflegeausbildung mit hochmodernem Skills-Lab

KOBLENZ Die letzten Arbeiten sind abgeschlossen und mittlerweile ist es einsatzbereit: das sogenannte Skills-Lab des Fachbereiches Pflege der Julius-Wegeler-Schule am Standort Finkenherd. Mit Hilfe dieses technisch hochentwickelten Pflegeraums erhalten Auszubildende in den Pflegeberufen die Möglichkeit, unter anderem Pflegehandlungen an einer Hightech-Übungspuppe umzusetzen.
„Wir haben hier eine simulative Lernumgebung geschaffen, in der wir Situationen aus der realen Welt nehmen und diese hier projizieren. Die Schülerinnen und Schüler setzen so ihr Gelerntes praxisnah um und es entstehen Lerneffekte aus der Simulation heraus, mit der wir das Lernen weiter fördern“, erklärt Oberstudienrätin Aida Drews, die mit ihrer Kollegin Rebecca Saxer die Idee für die neue Einrichtung hatte.
Bildungsdezernent Ingo Schneider besucht neue Einrichtung an Julius-Wegeler-Schule
In Zusammenarbeit mit der Abteilung Pflege der Julius-Wegeler-Schule hat das Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz mit rund 125.000 Euro die Einrichtung des Skills-Lab ermöglicht. Damit ist eine zeitgemäße Ausbildung der angehenden Pflegefach- und Pflegehilfskräfte an der Julius-Wegeler-Schule sichergestellt.
Bildungsdezernent Ingo Schneider nutzte die Gelegenheit nun, um sich vor Ort selbst bei einer Praxisübung von den Vorteilen des Skills-Labs für die Auszubildenden in der Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. -mann zu überzeugen. „Die Demonstration hat gezeigt, wie praxisnah das Skills-Lab ist. An dieser Stelle konnte eine Lücke in der Ausbildung des Fachbereichs Pflege geschlossen werden mit höchst innovativen Methoden. Die Schülerinnen und Schüler sind wirklich ganz nah dran und bekommen im Nachgang das nötige Feedback, was ihnen im Lernprozess weiterhilft. Die Investition in diese Technik hat sich definitiv gelohnt und ist eine sehr gute Ergänzung des Ausbildungsangebotes“, freute sich Schneider über das neue Angebot.
Martin von Jena, Fachbereichsleiter Pflegeberufe an der Julius-Wegeler-Schule, nutzte ebenso wie Schulleiter Carsten Müller die Gelegenheit, um sich stellvertretend beim Koblenzer Bildungsdezernenten für die Unterstützung der Stadt zu bedanken: „Dieses Skills-Lab, welches mit neuester Technik ausgestattet ist, bietet unseren Auszubildenden die Möglichkeit in einem geschützten Raum berufliche Handlungen unmittelbar umzusetzen und zu reflektieren. Die Stadt Koblenz hat mit dieser großen Investition die Bedeutung der beruflichen Bildung – in diesem Fall im Pflegeberuf – deutlich gemacht. Dafür gebührt unser Dank.“
 Bildungs- und Kulturdezernent Ingo Schneider (rechts) verschaffte sich in der Julius-Wegeler-Schule am Standort Finkenherd eine persönlichen Eindruck vom neuen Skills-Lab, das bei der Pflegeausbildung zum Einsatz kommt. | Stadt Koblenz/Andreas Egenolf
Bildungs- und Kulturdezernent Ingo Schneider (rechts) verschaffte sich in der Julius-Wegeler-Schule am Standort Finkenherd eine persönlichen Eindruck vom neuen Skills-Lab, das bei der Pflegeausbildung zum Einsatz kommt. | Stadt Koblenz/Andreas Egenolf -

 Allgemeinvor 2 Jahren
Allgemeinvor 2 JahrenRhein-Lahn-Kreis feiert 1. Mai – Wir waren in Dornholzhausen, Nievern, Hirschberg und Fachbach – Video im Beitrag
-

 VG Loreleyvor 3 Jahren
VG Loreleyvor 3 JahrenVG Loreley bietet Sommerfreizeit für Kinder aus den Flutgebieten
-

 Koblenzvor 2 Jahren
Koblenzvor 2 JahrenKoblenz beschließt neue Baumschutzsatzung
-

 Schulenvor 2 Jahren
Schulenvor 2 JahrenVG Bad Ems-Nassau investiert in die Sanierung der Turnhalle der Freiherr-vom-Stein Schule Bad Ems
-

 Gesundheitvor 1 Jahr
Gesundheitvor 1 JahrPflegekammer RLP muss Beiträge an Mitglieder erstatten!
-

 Gesundheitvor 2 Monaten
Gesundheitvor 2 Monaten190 Mitarbeiter werden ab morgen im Elisabeth-Krankenhaus in Lahnstein entlassen: Hospital wird zur Psychiatrie!
-

 Rhein-Lahn-Kreisvor 1 Jahr
Rhein-Lahn-Kreisvor 1 JahrBeamtinnen auf Lebenszeit ernannt
-

 Lahnsteinvor 1 Jahr
Lahnsteinvor 1 JahrSorge vor Vollsperrung der B42 hält an