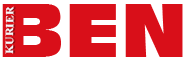Politik
JOBNOX als Spiegel des Arbeitsmarktes: Was bleibt, wenn die Messe geht?
 Die Edeka Nastätten im Gespräch mit einer Bewerberin.
Die Edeka Nastätten im Gespräch mit einer Bewerberin.
POHL Die Berufsmesse JOBNOX 2025 ist in vollem Gange – und das mit eindrucksvoller Bilanz: 115 Aussteller und über 1500 Schülerinnen und Schüler tummeln sich rund um das Limeskastell in Pohl. Die Wirtschaftsförderung als Veranstalter spricht sogar von 1800 Schülern. Bereits zum dritten Mal nach 2023 und 2024 öffnet das Karriere-Event seine Tore und hat sich laut der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn (WFG) zur größten Berufsmesse zwischen Frankfurt und Köln entwickelt. Eine Erfolgsgeschichte, die zugleich zum Nachdenken anregt – denn so sehr das Format boomt, so deutlich zeigt sich auch, wie tiefgreifend sich die Arbeitswelt verändert hat.
Die Zeiten haben sich geändert – und die Machtverhältnisse gleich mit
Früher dominierten Arbeitgeber den Bewerbungsprozess. Wer sich auf einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz bewarb, musste sich beweisen: Noten, Auftreten, Tests – alles war darauf ausgelegt, die Besten unter vielen zu identifizieren. Heute sieht das Bild anders aus: Der demografische Wandel hat das Kräfteverhältnis umgekehrt. Nicht mehr die Unternehmen wählen aus, sondern die Bewerber – und sie tun das mit wachsendem Selbstbewusstsein. Der Wandel ist so gravierend, dass Unternehmen inzwischen Benefits bieten müssen, die vor einigen Jahren noch undenkbar waren.
Ob finanzierte Fitnessstudio-Mitgliedschaften, betriebliches Gesundheitsmanagement, ergonomische Sitzmöbel oder die obligatorische Obstschale: Wer heute Azubis oder Fachkräfte gewinnen will, muss sich ins Zeug legen. Einerseits ist das Ausdruck einer begrüßenswerten Wertschätzung der Mitarbeitenden. Andererseits wirft es Fragen auf: Ist das noch gesund? Ist das gerecht?
Von der Elite zur Mittelmäßigkeit?
Mit der Verschiebung des Arbeitsmarktes geht auch eine qualitative Herausforderung einher. Viele Betriebe berichten: Die fachliche Qualität der Bewerberinnen und Bewerber hat im Vergleich zu den 1980er- und 1990er-Jahren deutlich nachgelassen. Einst waren es strenge Auswahlkriterien, die über einen Ausbildungsplatz entschieden – heute reicht oft eine mäßige Schulnote gepaart mit etwas Motivation. Ein Zustand, der nicht pauschal zu kritisieren ist, aber ein Symptom für einen grundlegenden Strukturwandel darstellt.
Denn es ist die Nachfrage, die den Marktwert bestimmt. Und der ist hoch, wenn es an Bewerbern fehlt. Doch mit dem Angebot steigen auch die Zugeständnisse. Wo früher Leistung zählte, zählen heute Soft Skills – oder schlichtweg Verfügbarkeit.
Das Schulsystem als Teil des Problems?
Ein weiterer Aspekt ist das Bildungssystem selbst. Die Einführung der Realschule Plus, ursprünglich gedacht als Reform zur Entstigmatisierung, hat aus Sicht vieler Arbeitgeber zu einer Verwässerung der Leistungsdifferenzierung geführt. Früher konnte ein leistungsstarker Hauptschüler mit Realschulabschluss als solcher erkannt werden – heute verschwimmen die Grenzen. Das erschwert die Einschätzung der Eignung erheblich, insbesondere im Handwerk, wo praktische Fähigkeiten gefragt sind, aber die Noten häufig unklar interpretierbar sind.
Darüber hinaus wurde mit der Zusammenlegung von Hauptschule und Realschule nicht nur das Schulsystem vereinheitlicht, sondern auch der klassische Realschulabschluss in seiner Aussagekraft abgeschwächt. Einst galt er als verlässlicher Nachweis einer soliden, mittleren Bildungsqualifikation. Heute sehen viele Unternehmen in der Realschule Plus eher ein Gesamtschulmodell mit sehr heterogenem Leistungsbild – was die Einschätzung von Bewerberprofilen zusätzlich erschwert.
Wandel bei der JOBNOX – mehr Ernsthaftigkeit, weniger Event?
Auch bei der JOBNOX selbst ist dieser Wandel deutlich spürbar. Während in den ersten Jahren viele Schülerinnen und Schüler das Messeformat eher als Abenteuerspielplatz betrachteten – inklusive Aerotrim, Rennwagen und Hightech-Roboter – zeigt sich 2025 ein gemischteres Bild. Noch immer gibt es Jugendliche, die in Jogginghose und ohne jegliche Vorbereitung auftreten, doch viele treten inzwischen selbstbewusst und gepflegt auf, haben sich informiert, stellen gezielte Fragen.
Gleichzeitig bleibt der Eindruck, dass die Veranstaltung stellenweise eher an ein Event als an eine ernsthafte Berufsorientierung erinnert. Mitmachstationen und Showelemente ziehen Aufmerksamkeit – und lenken mitunter von der eigentlichen Intention ab. Die Gratwanderung zwischen Informationsmesse und Unterhaltungsplattform gelingt meistens, aber nicht immer.
Hinzu kommt, dass viele Schülerinnen und Schüler nicht freiwillig zur JOBNOX kommen. Der Messebesuch ist häufig fester Bestandteil des Schuljahres und wird klassenweise organisiert – unabhängig vom individuellen Interesse. Das ist verständlich im Sinne der Chancengleichheit, wirft aber die Frage auf, wie sinnvoll eine Begegnung ist, wenn eine echte Auseinandersetzung mit den Themen gar nicht gewünscht ist. Wer ohne Motivation oder Vorbereitung erscheint, wird selten von einem Gespräch auf Augenhöhe profitieren – und vermittelt den Unternehmen ein verzerrtes Bild.
Ein Plädoyer für Klarheit und Konsequenz
So wichtig es ist, auf Augenhöhe zu kommunizieren – so notwendig ist auch wieder mehr Klarheit. Unternehmen, die Benefits bieten, haben ebenso das Recht, Voraussetzungen zu stellen. Wer bestimmte Schulnoten nicht erfüllt, kann sich in einem Praktikum empfehlen – aber nicht darüber hinwegsetzen. Es braucht Mut, dies offen zu kommunizieren: Wer will, der darf – aber wer nicht will oder sich nicht vorbereitet, gehört nicht zwangsläufig auf eine Messe wie die JOBNOX.
Hier wäre auch seitens der Schulen ein Umdenken notwendig. Eine verpflichtende Teilnahme für Schüler ohne jegliches Interesse ist wenig zielführend. Stattdessen sollten klare Kriterien gelten: Nur wer vorbereitet ist, Interesse zeigt und ernsthaft sucht, sollte den direkten Kontakt mit Arbeitgebern suchen. Das erleichtert den Unternehmen die Arbeit – und sorgt für Begegnungen, die echten Mehrwert bringen.
Zwischen Wandel und Wertediskussion
Die JOBNOX 2025 ist ein starkes Zeichen für die Region: Sie bringt Unternehmen und künftige Arbeitnehmer zusammen, bietet Chancen und eröffnet Perspektiven. Doch sie ist auch ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Veränderung. Der Arbeitsmarkt ist im Umbruch – und mit ihm das Verhältnis von Leistung, Anspruch und Angebot.
Jetzt braucht es eine neue Ehrlichkeit im Umgang miteinander. Schüler dürfen selbstbewusst auftreten – aber auch respektvoll. Unternehmen dürfen umwerben – aber auch fordern. Und alle gemeinsam sollten sich fragen: Wie viel Augenhöhe ist möglich, ohne das Leistungsprinzip aufzugeben?
Denn am Ende zählt nicht nur der Obstkorb – sondern das, was jeder Einzelne bereit ist, einzubringen.
Politik
Mittelrheinbrücke: Streit um Unterhaltungskosten noch vor dem ersten Spatenstich

LORELEY DIE ZEIT berichtete zuerst über eine Debatte, die zeigt, wie sensibel große Infrastrukturprojekte im Mittelrheintal politisch und finanziell sind: Noch bevor die geplante Mittelrheinbrücke bei St. Goar und St. Goarshausen gebaut ist, entzündet sich bereits ein Streit über die Frage, wer später für die Unterhaltungskosten aufkommen soll.
Auslöser war eine schriftliche Antwort des rheinland-pfälzischen Verkehrsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage zweier CDU-Abgeordneter (Matthias Lammert und Tobias Vogt – CDU). Darin machte Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) deutlich, dass das Land Rheinland-Pfalz keine dauerhafte Beteiligung an den laufenden Unterhaltungskosten der Brücke plane. Gleichzeitig stellte sie jedoch in Aussicht, dass das Land bis zu 90 Prozent der Baukosten übernehmen wolle, vorbehaltlich künftiger Haushaltsentscheidungen.
Ein Projekt mit langer Vorgeschichte
Die Mittelrheinbrücke soll eine feste Rheinquerung in der Verbandsgemeinde Loreley schaffen und damit eine Lücke zwischen Mainz und Koblenz schließen. Über das Projekt wird seit Jahren diskutiert. Bereits vor längerer Zeit wurde ein Architekten- und Planungswettbewerb durchgeführt, später folgte ein Raumordnungsverfahren, das 2023 abgeschlossen wurde. Einen konkreten Baubeginn gibt es bislang jedoch nicht.
CDU warnt vor Scheitern des Projekts
Aus der CDU kommt scharfe Kritik an der Haltung des Verkehrsministeriums. Der Landtagsabgeordnete Tobias Vogt sieht das Projekt gefährdet, sollte das Land dauerhaft keine Verantwortung für die Unterhaltung übernehmen. Sein Fraktionskollege Matthias Lammert betont die Bedeutung der Brücke für die Region und fordert eine umfassendere finanzielle Beteiligung des Landes. Gerade für finanziell stark belastete Kommunen sei es kaum leistbar, die Unterhaltung eines Bauwerks dieser Größenordnung allein zu stemmen.
Ministerium: Bau ist kommunale Aufgabe – Land hilft dennoch
Das Verkehrsministerium weist die Vorwürfe zurück. Ministerin Schmitt betont, dass es sich bei der Mittelrheinbrücke formal um eine kommunale Brücke handle und die laufende Unterhaltung daher grundsätzlich Aufgabe der beteiligten Landkreise sei. Gleichzeitig verweist sie auf die außergewöhnlich hohe Förderquote beim Bau und signalisiert Gesprächsbereitschaft für die Zukunft.
Sollten später größere Sanierungsmaßnahmen notwendig werden, schließt das Land eine finanzielle Unterstützung ausdrücklich nicht aus. Die Kommunen würden bei einem derart zentralen Infrastrukturprojekt nicht allein gelassen, so Schmitt.
Landkreise setzen auf Einigung
Auch die beteiligten Landkreise Rhein-Hunsrück und Rhein-Lahn zeigen sich bereits im Oktober 2025 vorsichtig optimistisch (wir berichteten hier). In einer gemeinsamen Stellungnahme heißt es, man habe sich mit dem Land grundsätzlich auf eine Förderung von 90 Prozent der Baukosten verständigt. Weitere Gespräche zur Ausgestaltung der Finanzierung stünden noch aus.
Angesichts der Dimension des Projekts liege es im Interesse der Kreise, dass sich das Land auch langfristig möglichst stark beteilige, insbesondere bei der späteren Unterhaltung. Diese müsse ebenfalls angemessen gefördert werden, um die kommunalen Haushalte nicht zu überfordern.
Ob und in welcher Form sich das Land künftig an den Unterhaltungskosten beteiligen wird, ist derzeit noch offen. Klar ist jedoch: Die Diskussion um die Mittelrheinbrücke hat längst eine neue Phase erreicht und sie beginnt nicht erst mit dem Bau, sondern schon mit der Frage, wer die Verantwortung trägt, wenn das Bauwerk eines Tages Realität wird (dk).
Politik
Prügel an Kindern, Rassismus, Holocaust: Der AfD-Eklat um Jo Meurer in Ransbach-Baumbach beschäftigt weiter In dem hessencam-Interview äußerte sich Jo Meurer unter anderem über angebliche Inzucht bei Muslimen, rechtfertigte Gewalt gegen Kinder und relativierte den Holocaust

RANSBACH-BAUMBACH Es sind Sätze, die man nicht vergisst, wenn man sie einmal gehört hat. Sätze über Kinder, die geschlagen werden. Über Menschen, die angeblich weniger wert seien. Über den Holocaust, der relativiert wird. Gesprochen werden sie von einem Mann, der bis vor wenigen Tagen Stadtrats- und Verbandsgemeinderatsmitglied in Ransbach-Baumbach war.
Jo Meurer steht vor der Stadthalle, am Rand eines AfD-Bürgerdialogs. Vor ihm die Kamera von hessencam, hinter der Joachim Schaefer steht. Was als Interview beginnt, entwickelt sich zu einem Protokoll radikaler Enthemmung.
Meurer spricht über seine Zeit als Lehrer. Auf die Nachfrage, ob er Kinder geschlagen habe, antwortet er ohne Zögern mit Ja. Er schildert einen konkreten Fall: Ein Schüler habe geschrien, er habe weiter geprügelt und erklärt, er werde nicht aufhören, solange der Junge nicht still sei. Später sagt Meurer, auch seine Enkelin habe er geschlagen, unter anderem im Kleinkindalter. Er beschreibt diese Gewalt nicht als Fehler, nicht als Unrecht, sondern als Teil seiner Vorstellung von Erziehung.
Im weiteren Verlauf richtet sich Meurers Blick auf ganze Bevölkerungsgruppen. Über Muslime sagt er, sie entwickelten sich nicht weiter, sie seien primitiv. Muslimische Kinder würden den Unterricht stören und »nichts bringen«. Er behauptet, ein erheblicher Teil der in Deutschland geborenen Muslime sei »behindert durch Inzucht«. Er spricht über Schulklassen mit »30 Prozent solcher Kinder« und stellt die Frage, was man mit ihnen machen solle. Seine Antwort: keine weiteren aufnehmen, die anderen abschieben. Auf Nachfrage bejaht er sinngemäß, dass staatliche Stellen auch in Schulen eingreifen könnten, um Kinder abzuholen und abzuschieben.
Dann spricht Meurer über Menschen afrikanischer Herkunft. Er sagt, sie hätten im Durchschnitt weniger intelligente Gene als Deutsche. Auch hier stellt er Herkunft als biologisches Schicksal dar, nicht als soziale oder individuelle Frage.
Spätestens an diesem Punkt wird deutlich, dass es in diesem Interview nicht um zugespitzte politische Meinungen geht, sondern um ein geschlossenes Weltbild. Herkunft, Religion und angebliche Leistungsfähigkeit werden miteinander verknüpft. Menschen erscheinen nicht als Individuen, sondern als Gruppen mit festgeschriebenen Eigenschaften.
Noch schwerer wiegen Meurers Aussagen zur deutschen Geschichte. Er greift den Begriff der sogenannten „Holocaust-Industrie“ auf und behauptet, Juden hätten den Holocaust »industrialisiert«. Die Zahl der Toten, sagt er sinngemäß, sei hochgerechnet worden, um Geld zu erhalten. Der Holocaust erscheint in seinen Worten nicht als beispielloses Verbrechen, sondern als etwas, über das man verhandeln könne. Die Erinnerungskultur erklärt er für beendet. Der »Schuldkult« sei vorbei, sagt Meurer. Er selbst sei 1944 geboren und trage keine Verantwortung.
In einer weiteren Passage spricht Meurer über deutsche Geschichte und Technik und formuliert dabei einen Satz, der fassungslos macht: Niemand sei so in der Lage gewesen, Millionen Menschen in so kurzer Zeit zu vergasen wie die Deutschen. Der industrielle Massenmord erscheint in diesem Moment nicht als Verbrechen, sondern als zynisch verzerrte »Leistung«.
Zwischen diesen Aussagen äußert sich Meurer immer wieder zur AfD. Er bezeichnet Björn Höcke nicht als Nazi oder Rechtsextremisten, obwohl dieser öffentlich als rechtsextrem eingestuft ist. Er sieht in der AfD die einzige Partei, die »realistisch« denke.
Das Video wird nach der Veröffentlichung tausendfach aufgerufen und verbreitet. Die Reaktionen in Ransbach-Baumbach folgen schnell. Stadt und Verbandsgemeinde veröffentlichen eine Erklärung, in der sie sich ausdrücklich von den Aussagen distanzieren und diese verurteilen. Es handele sich um persönliche Äußerungen, die in keinem Zusammenhang mit der Arbeit der kommunalen Gremien stünden. Weitere Konsequenzen, so heißt es, lägen nicht im Zuständigkeitsbereich der Kommune, sondern bei zuständigen Behörden.
Kurz darauf legt Jo Meurer alle politischen Ämter nieder, im Stadtrat, im Verbandsgemeinderat und in Ausschüssen. Auch innerhalb der AfD folgen Reaktionen. Parteiintern werden Schritte bis hin zu einem Parteiausschluss angekündigt; Meurer tritt aus der AfD aus. Weitere AfD-Mandatsträger in Ransbach-Baumbach erklären ihren Rücktritt und distanzieren sich von den Aussagen.
Ob einzelne Passagen des Interviews strafrechtlich relevant sind, müssen Ermittlungsbehörden prüfen. In Betracht kommen je nach Wortlaut und Kontext unter anderem Fragen der Volksverhetzung, der strafrechtlichen Bewertung von Holocaust-Relativierungen sowie der Einordnung der Aussagen über Gewalt gegen Kinder. Zum Zeitpunkt der öffentlichen Stellungnahmen lagen nach bekannten Angaben noch keine bestätigten Ermittlungsverfahren vor.
Das Interview wurde von Hessencam geführt, einem Projekt, das seit Jahren politische Gespräche dokumentiert und öffentlich zugänglich macht. Hessencam erreicht mit seinem YouTube-Kanal eine hohe Reichweite und ist wiederholt Ziel von Angriffen und rechtlichen Auseinandersetzungen geworden. Der Fall Meurer zeigt, welche Rolle solche dokumentarischen Formate spielen: Sie halten fest, was gesagt wird und überlassen die Bewertung der Öffentlichkeit und den zuständigen Stellen. (dk)
Anmerkung: Copyright des Videos liegt bei hessencam. Danke, dass wir es für die Berichterstattung nutzen durften!
Politik
Bundesfinanzhof hält Grundsteuerreform für verfassungsgemäß

POLITIK Der Bundesfinanzhof (BFH) hat die seit 2025 geltende Grundsteuerreform bestätigt. Drei Eigentümer aus Köln, Berlin und Sachsen hatten gegen das neue Bewertungsverfahren geklagt – ohne Erfolg. Schon die Vorinstanzen hatten ihre Klagen zurückgewiesen. Ob die Kläger nun das Bundesverfassungsgericht anrufen, ist offen.
Die Grundsteuer betrifft Eigentümer wie Mieter, da Vermieter die Abgabe in der Regel weitergeben. Kritiker hatten bemängelt, dass Finanzämter bei der Bewertung auf pauschale Durchschnittswerte zurückgreifen dürfen. Der BFH sah darin jedoch keinen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz. Gegenstand der Entscheidungen war das sogenannte Bundesmodell, das in den meisten Ländern gilt. Einige Länder haben eigene Modelle entwickelt, die ebenfalls rechtlich umstritten sind.
Auslöser der Reform war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2018. Die alten Berechnungsgrundlagen stammten teils aus den 1960er oder sogar 1930er Jahren und führten zu erheblichen Ungleichbehandlungen.
-

 Allgemeinvor 4 Jahren
Allgemeinvor 4 JahrenRhein-Lahn-Kreis feiert 1. Mai – Wir waren in Dornholzhausen, Nievern, Hirschberg und Fachbach – Video im Beitrag
-

 VG Loreleyvor 4 Jahren
VG Loreleyvor 4 JahrenVG Loreley bietet Sommerfreizeit für Kinder aus den Flutgebieten
-

 Schulenvor 4 Jahren
Schulenvor 4 JahrenVG Bad Ems-Nassau investiert in die Sanierung der Turnhalle der Freiherr-vom-Stein Schule Bad Ems
-

 Koblenzvor 4 Jahren
Koblenzvor 4 JahrenKoblenz beschließt neue Baumschutzsatzung
-

 Blaulichtvor 4 Monaten
Blaulichtvor 4 MonatenMillionenschäden bei Glasfaserausbau: Subunternehmer aus dem Rhein-Lahn-Kreis warten auf Gelder von Phoenix Engineering
-

 Koblenzvor 8 Monaten
Koblenzvor 8 MonatenKoblenz ausgebremst: Geplante Zug-Offensive scheitert an Bauchaos
-

 VG Nastättenvor 4 Jahren
VG Nastättenvor 4 JahrenAus für Endlichhofmilch? Zellmanns Birkenhof in Endlichhofen meldet Insolvenz an!
-

 VG Nastättenvor 1 Jahr
VG Nastättenvor 1 JahrLandwirt hat Tiere nicht im Griff: Kühe brechen immer wieder auf den Segelflugplatz Nastätten aus