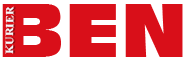VG Loreley
Das fetzt: Vom Dörscheider Dorfkind zum erfolgreichen Hotelier in Oberstdorf
 Foto: Ludger Fetz
Foto: Ludger Fetz
DÖRSCHEID/OBERSTDORF Die Reise beginnt in Dörscheid, einem kleinen Ort im Rhein-Lahn-Kreis. Hier, inmitten der malerischen Landschaft des Blauen Ländchens, wuchs Ludger Fetz auf. Doch der Weg des jungen Mannes sollte ihn weit hinausführen – nach Oberstdorf, wo er sich einen Namen als Hotelier mit Herzblut gemacht hat.
„Ich wollte die Welt sehen“
Nach seiner Kochlehre und der Zeit beim Bund wusste Fetz, dass er als Koch mehr erleben wollte. „Ich habe kurzerhand das Auto meines Vaters genommen und bin in ein Wintersportgebiet gefahren“, erzählt er. Die Wahl fiel auf das Walsertal, einen abgeschiedenen Ort in den Alpen. Der erste Eindruck des Betriebes, in dem er sich vorstellte, war jedoch ernüchternd: „Ich dachte mir, da fängst du niemals an – viel zu abgelegen.“
Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Während des Vorstellungsgesprächs fiel sein Blick auf eine junge Frau – die Tochter des Hauses. „Ich habe sofort gesagt: Hier möchte ich arbeiten. Ich wusste nicht, was ich verdienen würde oder welche Aufgaben mich erwarten, aber ich war sicher, dass ich hierbleiben wollte.“
Die Liebe und der Einstieg ins Familiengeschäft
Die Wintersaison wurde nicht nur beruflich, sondern auch privat ein voller Erfolg: Ludger und seine zukünftige Frau wurden ein Paar. Gemeinsam kehrten sie nach Dörscheid zurück, wo sie sieben Jahre lang den elterlichen Betrieb von Ludgers Familie führten. Diese Zeit war geprägt von harter Arbeit und wertvollen Erfahrungen.
„Wir haben viele Dinge gelernt, unter anderem, wie wichtig es ist, Tradition und Innovation zu verbinden. Mein Vater hat uns oft gebremst, aber rückblickend war das genau richtig.“
Trotz der lehrreichen Jahre war der Wunsch nach einem eigenen Restaurant immer präsent. So zog das Paar schließlich nach Oberstdorf, um das Elternhaus seiner Frau, ein altes Bauernhaus, zu übernehmen.
Vom Bauernhaus zum erfolgreichen Hotelbetrieb
Das neue Projekt begann mit bescheidenen Mitteln: „Es gab sechs oder sieben Gästezimmer, alle mit Waschbecken im Raum und einer Gemeinschaftsdusche auf dem Flur.“ Schritt für Schritt renovierten und erweiterten sie das Haus, bauten ein kleines Restaurant in den ehemaligen Kuhstall und richteten Ferienwohnungen ein.
Die Anfangsjahre waren hart. „Wir hatten keinen Ruhetag und führten das Restaurant allein. Es war eine intensive Zeit, aber wir haben viel gelernt.“ Heute ist das „Das Freiberg“ ein Betrieb mit 56 Mitarbeitern, der weit über die Grenzen Oberstdorfs hinaus bekannt ist.
Ein Hotel, das Geschichten erzählt
Das Besondere am Freiberg ist die außergewöhnliche Gestaltung. „Unser Hotel soll wie eine Wandertour sein. Hinter jeder Ecke gibt es etwas Neues zu entdecken“, erklärt Fetz. Gemeinsam mit einem befreundeten Architektenpaar, das zuvor noch nie ein Hotel gestaltet hatte, schufen sie eine einzigartige Atmosphäre.
„Ein Hotel sollte keine Kopie des Alltags sein. Es muss den Gast in eine andere Welt entführen. Bei uns findet man Farben, Kunstobjekte und Designs, die überraschen und inspirieren.“
Familie und Beruf: Eine perfekte Symbiose
Fetz betont immer wieder, wie wichtig ihm die Unterstützung seiner Frau ist: „Sie ist der kreative Kopf hinter vielen Dingen, die unser Hotel ausmachen. Ich könnte mir keine bessere Partnerin vorstellen.“ Auch ihre beiden Söhne und Schwiegertochter sind mittlerweile Teil des Betriebs, was Ludger und seiner Frau etwas mehr Freiraum gibt.
„Heute gönnen wir uns einen freien Tag in der Woche und zweimal im Jahr eine Auszeit. Diese Zeiten nutzen wir, um gemeinsam gutes Essen und schöne Orte zu genießen.“
Rückblick und Ausblick
Nach 33 Jahren in Oberstdorf blickt Ludger Fetz zufrieden auf das Erreichte zurück. „Ich habe das Glück, in einer der schönsten Regionen Deutschlands zu leben und einen Beruf auszuüben, der mich erfüllt. Unser Ziel war es immer, den Gästen eine Auszeit vom Alltag zu schenken – und das werden wir auch weiterhin tun.“
Sein Rat an junge Menschen: „Bleibt neugierig, arbeitet hart und habt keine Angst vor Fehlern. Denn genau diese bringen euch weiter.“
BEN Radio
Zum Jahreswechsel: Danke für Vertrauen, Hinweise und Kritik

RHEIN-LAHN Mit dem Übergang von 2025 zu 2026 endet für den BEN Kurier ein weiteres intensives Jahr regionaler Berichterstattung. Ein Jahr mit vielen Themen, Gesprächen, Recherchen und Geschichten aus unserer Heimat – getragen vor allem von den Menschen, die diese Region ausmachen.
Journalismus lebt vom Vertrauen der Leserinnen und Leser. Vom offenen Hinweis, von der kritischen Nachfrage, vom Widerspruch ebenso wie von der Zustimmung. Auch im vergangenen Jahr haben uns zahlreiche Hinweise erreicht, viele davon aus der Mitte der Gesellschaft. Sie haben Themen angestoßen, Missstände sichtbar gemacht, Entwicklungen begleitet und Diskussionen ermöglicht. Dafür sagen wir ausdrücklich Danke.
Der BEN Kurier versteht sich als unabhängiges regionales Medium. Unser Anspruch ist es, sachlich zu berichten, kritisch nachzufragen und Entwicklungen transparent darzustellen, unabhängig von parteipolitischen oder persönlichen Interessen. Gerade auf kommunaler Ebene ist dies nicht immer bequem, aber notwendig. Demokratie lebt von Öffentlichkeit, und Öffentlichkeit braucht verlässliche Informationen.
2025 war zugleich ein Jahr, das gezeigt hat, wie wichtig lokaler Journalismus weiterhin ist. Entscheidungen vor Ort, gesellschaftliche Debatten, ehrenamtliches Engagement, wirtschaftliche Herausforderungen und persönliche Schicksale, all das findet nicht abstrakt statt, sondern direkt vor unserer Haustür. Diese Nähe verpflichtet zu Sorgfalt, Verantwortung und Fairness.
Zum Jahreswechsel blicken wir mit Dankbarkeit auf das Erreichte und mit Verantwortung auf das Kommende. Auch 2026 wird der BEN Kurier aufmerksam hinschauen, zuhören und berichten. Nicht lauter als nötig, aber klar. Nicht gefällig, sondern verlässlich. Wir danken allen Leserinnen und Lesern für ihr Vertrauen, ihre Unterstützung und ihre kritische Begleitung.
Der BEN Kurier wünscht einen guten und sicheren Start ins Jahr 2026.
VG Loreley
Neues Verwaltungsgebäude in St. Goarshausen: Die Vorwürfe waren laut – der Faktencheck ist lauter! Onlinemedium bringt unhaltbare Vorwürfe: Planungsstände mit Realität verwechselt

ST. GOARSHAUSEN Rund um das neue Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Loreley in St. Goarshausen ist in den vergangenen Tagen ein Bild entstanden, das viele sofort triggert: Da war plötzlich in einem Onlinemedium die Rede von einer angeblichen Wellnessoase für den Bürgermeister, von einer ausschweifenden Dachterrasse, von einer »gläsernen« Loggia, von einer aufwendig inszenierten Tiefgarage, kurz: von Luxus statt Funktion, von Komfort statt Verwaltung, von Steuergeld für Annehmlichkeiten. Grundlage für diese Debatte sind Anmerkungen aus dem Kommunalbericht 2025, in dem der Rechnungshof Rheinland-Pfalz die Planung und Ausführung des Projekts kritisch beleuchtet.
Genau an diesem Punkt beginnt aber das, was saubere, neutrale Pressearbeit ausmacht: Wer schwere Vorwürfe oder zugespitzte Bilder in den Raum stellt, muss sie überprüfen. Dazu gehört, Betroffene zu Wort kommen zu lassen und, wenn es möglich ist, sich selbst ein Bild vor Ort zu machen. Nur so können Leser informiert werden, nicht mit Schlagworten, sondern mit überprüfbaren Fakten.
Der BEN Kurier war deshalb vor Ort. Wir haben das Verwaltungsgebäude von innen besichtigt und mit Verbandsbürgermeister Mike Weiland gesprochen. Begleitet wurde der Termin von unserer Kollegin Jennifer Schmidt, die den BEN Kurier ehrenamtlich als Reporterin unterstützt. Und das Ergebnis dieser Besichtigung ist eindeutig: Mehrere Kernaussagen, die sich aus dem Prüfbericht und der zugespitzten Weitererzählung in der öffentlichen Debatte verselbständigt haben, halten der Realität im Gebäude nicht stand.
Wie aus Kritik ein Luxus-Narrativ wurde
Der Kommunalbericht 2025 enthält Hinweise und Kritikpunkte zur Planung, zu Flächen, zu Ausstattungsstandards und zur Wirtschaftlichkeit. Solche Prüfanmerkungen sind wichtig, gerade bei Projekten dieser Größenordnung. Problematisch wird es jedoch, wenn aus Prüfsätzen ein Gesamtbild gebaut wird, das »Luxus für den Chef« suggeriert, ohne den Abgleich mit dem tatsächlichen Planungsstand und dem tatsächlichen Bauzustand zu leisten.
Vor Ort zeigt sich: Viele der Reizworte, die in der Debatte hängen geblieben sind, beschreiben entweder längst überholte Planungsstände , oder sie treffen die Sache sprachlich so verzerrt, dass beim Leser ein falscher Eindruck entsteht.
Die Dachterrasse: was tatsächlich oben liegt
Eines der stärksten Bilder in der Debatte war die Dachterrasse. Das klingt nach Liegestühlen, Ausblick, Privatbereich. Vor Ort ist davon nichts zu sehen und vor allem: Es ist baulich etwas völlig anderes. Was oben als Terrasse gelesen wurde, ist in der Realität die Dacheindeckung über dem darunterliegenden Trauzimmer- und Aufenthaltsbereich. Eine nutzbare Dachterrasse im klassischen Sinn wird es nicht geben. Der angrenzende Bereich, der im Prüfkontext mit 36 Quadratmetern im Raum stand, ist nach Anpassungen nicht nur kein Luxus, sondern ein deutlich kleiner dimensionierter Funktionsraum: 21,3 Quadratmeter, nachgemessen und verkleinert.
Kurz: Das Dachterrassen-Narrativ fällt beim ersten Blick durch die Tür. Es ist »Dach«. Und darunter ein Trauzimmer mit Besprechungsraum, das Aufgaben erfüllt, die bisher Geld kosten, jedes Mal aufs Neue.
Die Wellnessoase: Dusche ja, Luxus nein
Das zweite Schlagwort war die »Wellnessoase«. Es ist das klassische Empörungs-Reizwort: Wer will schon, dass Steuergeld in Wohlfühlbereiche fließt?
Die Realität im Gebäude ist nüchtern. Im sogenannten Bürgermeisterbereich, der nicht »Bürgermeister allein« ist, sondern Arbeitsplätze von Bürgermeister und Vorzimmer umfasst, findet sich eine zu errichtende Nasszelle: Toilette, Handwaschbecken, und eine Dusche, ohne Kabine, ohne Inszenierung. Dazu eine kleine Teeküche, die nicht exklusiv gedacht ist, sondern das Gebäude mitversorgt. »Wellness« ist dafür ersichtlich die falsche Vokabel.
Entscheidend ist auch: Diese Dusche ist nicht als Privatkomfort geplant, sondern in vielen Verwaltungen (z.B. Kreisverwaltung und anderen Verbandsgemeindeverwaltungen) sind solche Sanitärlösungen längst normal, gerade wenn Termine eng getaktet sind und Mitarbeiter auch außerhalb klassischer Bürozeiten im Einsatz sind.
Dazu kommt ein Punkt, der in der moralischen Aufladung gern unterschlagen wird: Ein Verbandsbürgermeister arbeitet nicht von »neun bis fünf«. In der Praxis sind Wochen mit sehr hoher Stundenzahl Realität. Wer von Termin zu Termin geht, Sitzungen, Bürgertermine, Außentermine, Krisenlagen, Baustellen, Repräsentation, der verbringt einen großen Teil seiner Zeit im Büro. Es ist, übersetzt in Alltagslogik, oft eher »Wohnzimmer« als Schreibtischplatz. Und gerade im Sommer ist eine kurze Dusche zwischen Terminen kein Luxus, sondern schlicht funktional, bevor es weitergeht.
Das ist die eigentliche Entlarvung: Aus einem normalen, schlichten Bad mit Dusche wurde rhetorisch eine »Oase«. Die zu errichtende spartanische Nasszelle selbst widerspricht dieser Erzählung.
Dazu noch die Sage mit dem überdimensionierten Bürgermeisterbüro: Die oft zitierte Zahl von 63 Quadratmetern beschreibt nicht ein einzelnes Büro, sondern einen bereits verkleinerten Arbeitsbereich von etwa 57 Quadratmetern inklusive Vorzimmer mit zwei Arbeitsplätzen sowie Teeküche und Sanitär und wirkt damit, verglichen mit den Bürgermeisterzimmern in anderen Verbandsgemeinden, eher klein und spartanisch als luxuriös. Das Bürgermeisterzimmer hat lediglich 28,4 Quadratmeter und nicht 63 Quadratmeter.
Das gläserne Trauzimmer: Planstand vs. Realität
Das nächste Bild: »komplett verglast«. Auch hier wirkt das Wort wie ein Trigger: teuer, extravagant, Showarchitektur. Vor Ort ist entscheidend, was inzwischen umgesetzt und geändert wurde.
Im Gespräch und anhand des Bauzustands wird klar: Eine vollständig bodentiefe Verglasung war in einer frühen Planung einmal enthalten, wurde aber nach Hinweisen angepasst. Die Fassade wurde verändert, Fenster nicht mehr durchgehend bodentief ausgeführt, ausdrücklich auch aus Effizienz-, Energie- und Kostengründen sowie mit Blick auf Folgekosten.
Das heißt: Wer heute noch mit dem Etikett »voll verglast« arbeitet, beschreibt nicht den aktuellen Stand. Und genau hier kippt der Unterschied zwischen Kritik und Verzerrung: Prüfer können frühere Planungen kritisieren, aber Berichterstattung muss dann sauber trennen, ob der kritisierte Zustand noch gilt oder bereits korrigiert wurde.
Die »flutbare Tiefgarage« und warum sie eher ein Carport ist
Kaum ein Begriff klang in der Debatte so nach Bau-Spielerei wie die »flutbare Tiefgarage«. Wer das liest, denkt an ein teures Untergeschoss, aufwendig abgedichtet, technisch kompliziert.
Vor Ort ist das Bild ein anderes: Unter dem aufgeständerten Gebäude entstehen Stellplätze. Nicht als geschlossene, in den Boden eingelassene Tiefgarage, sondern als durchflutbarer Bereich, treffender beschrieben als Carport unter dem Gebäude. Genau das ist im Hochwassergebiet der entscheidende Punkt: Ein geschlossener, erdberührter Tiefgaragen-Bau wäre nach Hochwasserereignissen mit erheblichem Reinigungs- und Schadensrisiko verbunden. Die offene, durchflutbare Lösung reduziert Folgekosten und passt zur gesamten Bauweise auf Stelzen.
Hier zeigt sich ein Grundmuster: Wer ein Wort wie »Tiefgarage« setzt, erzeugt automatisch ein Luxusbild, obwohl die Konstruktion gerade eine Hochwasser-Notwendigkeit und eine Kostenbremse ist.
Dazu kommt ein weiterer Realitätscheck: Die bisherigen Verwaltungsstandorte liegen höhenmäßig tiefer. Hochwasser hat dort bereits Folgekosten erzeugt. Der Neubau ist so geplant, dass genau diese Schäden in Zukunft geringer ausfallen.
Das Hochwassergebie: nicht Wunsch, sondern Zwangslage
Ein Kernargument, das in der Debatte oft moralisch verkürzt wird: »Warum baut man überhaupt dort?« Die Antwort ist banal und politisch unbequem zugleich: Flächen sind knapp und Alternativen nicht vorhanden.
Nach Darstellung aus dem Projektprozess wurden seit 2020 verschiedene Möglichkeiten geprüft: Sanierung, Neubau, andere Bestandsgebäude. Am Ende blieb dieser Standort als realistische Option, auch wegen Erreichbarkeit für Bürger. Damit ist das Bauen im Hochwasserbereich keine romantische Idee, sondern eine Zwangslage und dann entscheidet nicht die Fantasie, sondern die Hochwasserschutzvorgabe: aufgeständertes Bauen, Einhaltung der maßgeblichen Hochwasserlinie.
Wer den Standort kritisiert, muss deshalb fairerweise zwei Dinge nebeneinander legen: ja, Hochwassergebiet ist ein Risiko. Aber nein, es ist nicht automatisch „leichtfertig“, wenn man zugleich so baut, dass das Risiko technisch minimiert wird, Folgekosten sinken und der Standort anhand von kaum vorhandener Flächen alternativlos war und in die Überlegungen von allen Institutionen mit einbezogen wurde.
1089 Quadratmeter: warum die Zahl nicht einfach so steht
Ein weiterer Aufreger war die Fläche: 1089 Quadratmeter. In der öffentlichen Debatte ist so eine Zahl schnell zu »groß«. Der Rechnungshof hinterfragt Diskrepanzen gegenüber bewilligten oder hergeleiteten Nutzflächen.
Vor Ort wird die Flächenfrage aber greifbarer, wenn man sie nicht als Zahl behandelt, sondern als Aufgabenpaket einer modernen Verwaltung: In den bisherigen Gebäuden fehlen Sozialraum, Besprechungsräume, ein vernünftiger Sitzungssaal; dazu kommen neue Aufgaben, die Kommunen seit Jahren zusätzlich schultern müssen: Krisenstäbe, Flüchtlingsbetreuung, Klimaschutz, Ganztagsförderung, immer neue Bundes- und Landesvorgaben. Und: Mit dem Neubau sollen Fachbereiche zusammengeführt werden, Räume werden unmittelbar belegt. Und eines wurde einfach vollkommen vergessen: Es gab einmal zwei Verbandsgemeinden: Loreley und Braubach und die werden nun weiter zusammengeführt. Von Tag eins an sind alle Räume vollständig belegt. Das schafft Synergien die vorher nicht einmal denkbar waren.
Hinzu kommen Standards, die Fläche fressen, ohne dass sie politisch vor Ort beschlossen wurden: Barrierefreiheit, Flurbreiten, Toilettenanforderungen pro Etage, Aufzug: Vorgaben aus Regelwerken, die sich kommunal kaum wegdiskutieren lassen. Das sind Quadratmeter, die in jeder Verwaltung entstehen, aber selten in Empörungsartikeln als Ursache auftauchen.
Kurz: 1089 Quadratmeter sind nicht automatisch Luxus. Die Zahl wird erst dann seriös bewertbar, wenn man sie mit Aufgaben, Pflichten und Standards zusammenliest und genau das fehlt in vielen zugespitzten Darstellungen indem die Fakten rigoros ignoriert oder nicht hinterfragt wurden.
Kosten, Anpassungen, Prüfhinweise – und was daraus geworden ist
Auch beim Geld lohnt der Blick auf den Stand: Im Interview wird ein veranschlagter Gesamtansatz von 9,2 Millionen Euro genannt; ein großer Teil sei bereits gebunden, und man liege aktuell unter der Kalkulation. Gleichzeitig wird eingeräumt, dass die Baupreise der vergangenen Jahre massiv gestiegen sind: Entwicklungen, die öffentliche Bauprojekte ebenso treffen wie private Bauherren (Ukrainekrise, gestiegene Preise für Baustoffe usw).
Wichtig in der Entlarvung ist aber weniger das politische Pro oder Contra zu Baukosten, sondern die Frage: Wurden Hinweise aufgegriffen? Nachweisbar ja, etwa bei der Reduzierung und Neubewertung von Flächen (Beispiel 36 → 21,3 Quadratmeter beim Aufenthaltsraum) und bei der Anpassung der Verglasung und Fensterstandards.
Das heißt nicht: »Alles ist perfekt.« Es heißt: Wer den Prüfbericht und seine Kritik zitiert, muss gleichzeitig zeigen, was inzwischen geändert wurde, sonst entsteht beim Leser eine Scheinrealität.
Realität schlägt Reizwort
Die Debatte um das Verwaltungsgebäude zeigt, wie schnell aus Prüfanmerkungen ein Empörungsfilm geschnitten werden kann, mit Begriffen, die im Kopf sofort Bilder erzeugen: Wellnessoase, Dachterrasse, gläsernes Trauzimmer, flutbare Tiefgarage. Der Vor-Ort-Check entzieht diesen Bildern den Boden.
Was im Gebäude tatsächlich zu sehen ist, ist funktionale Verwaltung: ein kleines zu errichtendes Sanitärbad mit Dusche statt »Oase«, ein Dach statt »Terrasse«, ein angepasstes Trauzimmer statt »Glaspalast«, Stellplätze unter einem aufgeständerten Gebäude statt »Tiefgaragen-Prestige«. Und die Flächen- und Kostenfragen werden erst dann fair, wenn man sie mit Aufgabenwachstum, Standards und Hochwasserschutzvorgaben zusammen betrachtet.
Wer das Projekt kritisch begleitet, darf und soll genau hinsehen. Aber wer kritisiert oder zugespitzt berichtet, muss ebenso konsequent prüfen, ob die zugespitzten Bilder stimmen. In St. Goarshausen zeigt sich: Mehrere zentrale Behauptungen, die derzeit kursieren, sind in dieser Form nicht Realität. Genau deshalb waren wir vor Ort. Genau deshalb ist der Faktenabgleich wichtiger als der lauteste Begriff.
VG Loreley
Geschafft: Freie Fahrt auf der L335 zwischen Dachsenhausen und Braubach

DACHSENHAUSEN|BRAUBACH Die L 335 zwischen Braubach und Dachsenhausen ist seit heute wieder für den Verkehr freigegeben. Damit endet eine lange Phase der Vollsperrung auf einem zentralen Abschnitt im Hinterland der Verbandsgemeinde Loreley. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez teilte mit, dass die Bauarbeiten an diesem Freitagabend abgeschlossen werden.
Baustelle seit Ende Juli: Lückenschluss auf knapp 2,7 Kilometern
Gebaut wurde auf dem Streckenabschnitt seit Ende Juli des vergangenen Jahres. Die Maßnahme schließt eine Lücke über rund 2,7 Kilometer zwischen zwei bereits fertiggestellten Teilabschnitten. In Dachsenhausen war die L 335 bereits 2014 auf etwa 1,1 Kilometern ausgebaut worden, bei Braubach folgte 2021/2022 ein weiterer Abschnitt über rund 1,7 Kilometer.
Dass die Arbeiten so stark wahrgenommen wurden, lag auch an der Verkehrsführung: Der betroffene Abschnitt war nicht halbseitig, sondern voll gesperrt. Für viele Pendler, Anwohner und Betriebe bedeutete das über Monate Umwege, zusätzliche Fahrzeiten und einen deutlich höheren Druck auf Ausweichrouten.
Verzögerung durch Schäden im Unterbau
Ursprünglich war die Hoffnung groß, die Strecke schon Ende Oktober wieder befahren zu können. Der Termin hielt jedoch nicht. Nach Angaben, die dem BEN Kurier vom Leiter des LBM Diez, Benedikt Bauch, übermittelt wurden, haben unerwartete Schäden im Unterbau den Zeitplan durcheinandergebracht. Die Folge: Die Asphaltierungsarbeiten dauerten länger als geplant – die Freigabe wurde auf 19. Dezember verschoben.
Der LBM nannte für die Schlussphase nicht nur die verlängerten Sanierungs- und Asphaltarbeiten, sondern auch typische Abschlussgewerke: Bankette, Schutzplanken sowie Fahrbahnmarkierung. Diese Punkte sind relevant, weil sie erklären, warum eine Straße nicht „irgendwie“ früher geöffnet wird: Ohne diese Arbeiten fehlt entweder Verkehrssicherheit oder es würden unmittelbar neue Einschränkungen entstehen.
Parallel lief eine Gemeinschaftsmaßnahme mit den Verbandsgemeindewerken Loreley. Im Zuge des Projekts wurde ein Schmutzwasserkanal hergestellt, um Dachsenhausen an die Gruppenkläranlage Lahnstein-Braubach anzuschließen. Bei den Investitionen nennt die Berichterstattung: rund 4,7 Millionen Euro vom Land Rheinland-Pfalz für den Straßen-Lückenschluss sowie rund 1,2 Millionen Euro der VG-Werke für den Kanal.
Was die Freigabe für die Region praktisch bedeutet
Mit der Wiedereröffnung endet nicht nur eine Baustelle – es endet vor allem der Umleitungsalltag. Die direkte Verbindung ist wieder da, der Verkehr verteilt sich wieder auf die dafür vorgesehene Landesstraße, und Nebenstrecken sowie Ortsdurchfahrten werden entlastet.
Im BEN-Kurier-Artikel war im Herbst auch ein Punkt aus der Bürgerschaft aufgegriffen worden: die Sorge, eine modernisierte und in Kurven entschärfte Strecke könne künftig mehr Verkehr anziehen. Ob das eintritt, bleibt abzuwarten – sicher ist zunächst vor allem: Der Verkehr fließt wieder dort, wo er hingehört.
Die Freigabe der L 335 zwischen Braubach und Dachsenhausen am 19. Dezember 2025 beendet eine Vollsperrung nach umfangreichen Bauarbeiten am Lückenschluss. Nach Verzögerungen durch Schäden im Unterbau ist die Strecke nun wieder durchgehend befahrbar, inklusive der notwendigen Abschlussarbeiten wie Schutzplanken, Bankette und Markierung.
-

 Allgemeinvor 4 Jahren
Allgemeinvor 4 JahrenRhein-Lahn-Kreis feiert 1. Mai – Wir waren in Dornholzhausen, Nievern, Hirschberg und Fachbach – Video im Beitrag
-

 VG Loreleyvor 4 Jahren
VG Loreleyvor 4 JahrenVG Loreley bietet Sommerfreizeit für Kinder aus den Flutgebieten
-

 Schulenvor 4 Jahren
Schulenvor 4 JahrenVG Bad Ems-Nassau investiert in die Sanierung der Turnhalle der Freiherr-vom-Stein Schule Bad Ems
-

 Koblenzvor 4 Jahren
Koblenzvor 4 JahrenKoblenz beschließt neue Baumschutzsatzung
-

 Blaulichtvor 4 Monaten
Blaulichtvor 4 MonatenMillionenschäden bei Glasfaserausbau: Subunternehmer aus dem Rhein-Lahn-Kreis warten auf Gelder von Phoenix Engineering
-

 Koblenzvor 8 Monaten
Koblenzvor 8 MonatenKoblenz ausgebremst: Geplante Zug-Offensive scheitert an Bauchaos
-

 VG Nastättenvor 4 Jahren
VG Nastättenvor 4 JahrenAus für Endlichhofmilch? Zellmanns Birkenhof in Endlichhofen meldet Insolvenz an!
-

 VG Nastättenvor 1 Jahr
VG Nastättenvor 1 JahrLandwirt hat Tiere nicht im Griff: Kühe brechen immer wieder auf den Segelflugplatz Nastätten aus