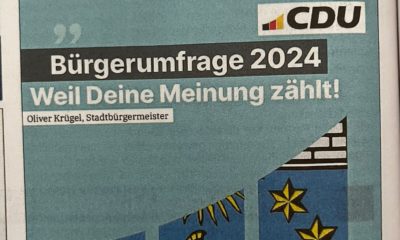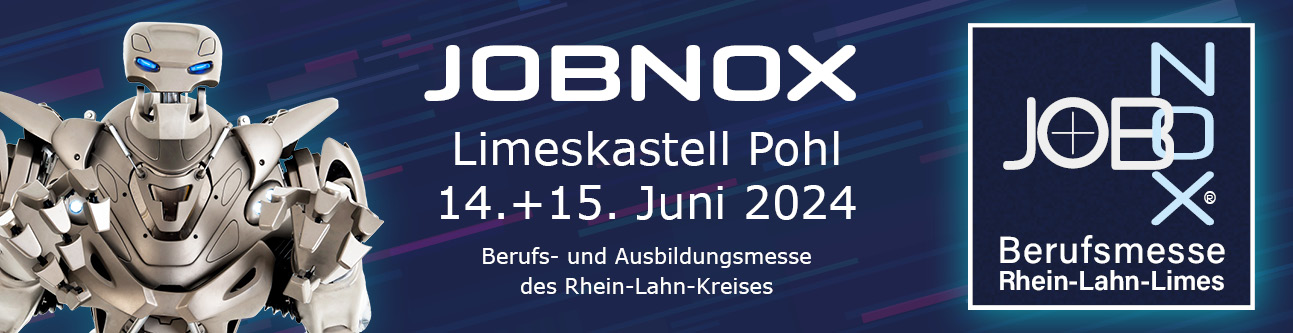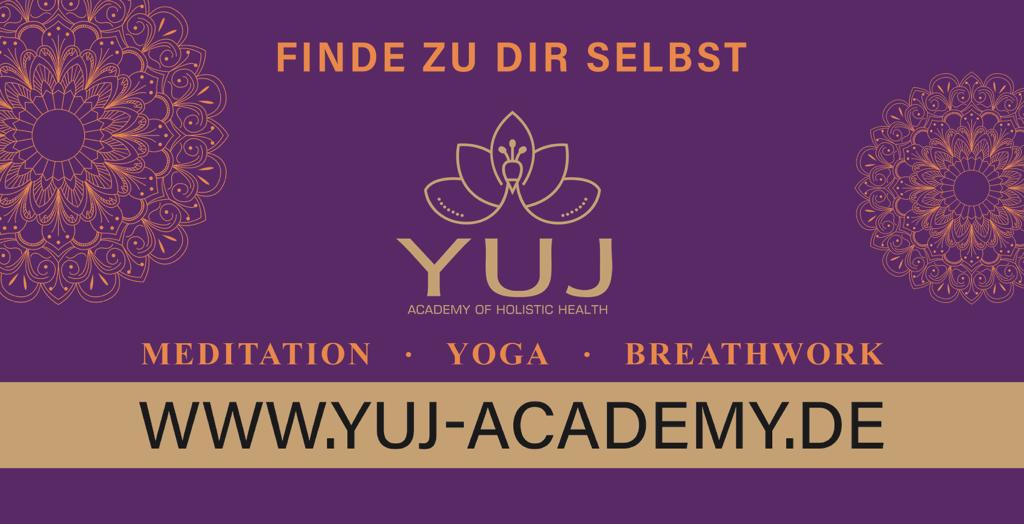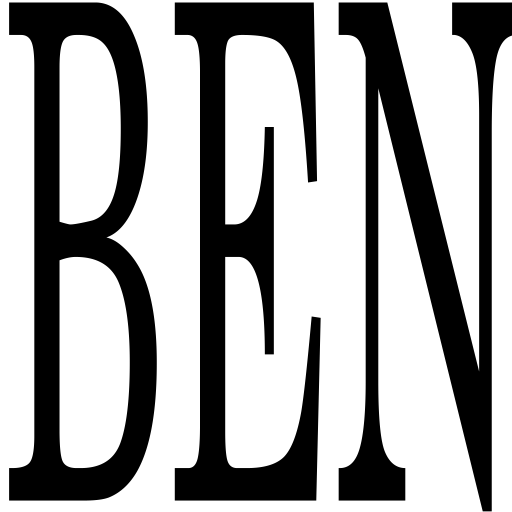Politik
Leni wartet auf ihr USA-Abenteuer
HEROLD/RHEIN-LAHN-KREIS – Eigentlich würde Leni Seelbach jetzt Koffer packen. Eigentlich würde die 15-Jährige sich in den nächsten Tagen von all ihren Freunden verabschieden.
 Mit MdB Dr. Andreas Nick (links) freut sich auch die ganze Familie von Leni: Vater Manfred, die Schwestern Ida und Liska, Bruder Niklas und Mutter Susanne (von links), dass sich der Traum von den USA – hoffentlich – möglichst bald erfüllt.
Mit MdB Dr. Andreas Nick (links) freut sich auch die ganze Familie von Leni: Vater Manfred, die Schwestern Ida und Liska, Bruder Niklas und Mutter Susanne (von links), dass sich der Traum von den USA – hoffentlich – möglichst bald erfüllt.
HEROLD/RHEIN-LAHN-KREIS – Eigentlich würde Leni Seelbach jetzt Koffer packen. Eigentlich würde die 15-Jährige sich in den nächsten Tagen von all ihren Freunden verabschieden. Eigentlich würde sie nochmal genau kontrollieren, ob sie ihren Reisepass, das Visum und alle wichtigen Unterlagen zur Hand hat für den Start in das bisher größte Abenteuer ihres Lebens: Ein Jahr in den USA als Absolventin des parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) des deutschen Bundestags.
Stattdessen heißt es nun warten, Plan B starten und hoffen, dass der Traum vom Auslandsjahr zumindest in verkürzter Form ab Januar Wirklichkeit wird.
Doch auch wenn die Corona-Pandemie momentan den Abflug verhindert, ist die Vorfreude riesig. Davon konnte sich nun Dr. Andreas Nick überzeugen: Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Montabaur ist im Rahmen seiner Sommertour in seinem Wahlkreis und damit auch im Rhein-Lahn-Kreis unterwegs. Dabei war es ihm besonders wichtig, die künftige PPP-Absolventin und ihre Familie zuhause zu besuchen. Beim gemütlichen Kaffeeklatsch mit der gesamten Familie – Leni hatte höchstpersönlich leckeren Beeren-Kuchen gebacken – tauschten sich die Teenagerin, ihre Familie und Andreas Nick sowie CDU-Wahlkreis-Referenten Marcel Willig in Herold intensiv über das geplante Auslandsjahr aus. Leni Seelbach hat erst vor wenigen Wochen ihr Abschlusszeugnis der Realschule plus/FOS im Einrich erhalten. Nach ihrem USA-Jahr möchte sie Abitur machen und einen Beruf im medizinischen Bereich erlernen.
15-jährige Leni Seelbach aus Herold hat sich als Stipendiatin des Bundestags durchgesetzt
Andreas Nick hatte sie zuletzt im Frühjahr während des mehrstufigen Auswahlverfahrens für das PPP gesehen. „Erst musste ich viele Formulare ausfüllen, dann gab es ein Gruppengespräch, dann ein Einzelgespräch“, berichtet sie über die Vorbereitungen im Frühjahr. Besonders wichtig war schließlich das Einzelgespräch, an das sich der CDU-Abgeordnete des Rhein-Lahn-Kreises Andreas Nick sehr gut erinnert: „Wir haben uns per Videoschalte unterhalten – Leni hat mich dabei durch ihre Art überzeugt: Sie ist ruhig, steht mit beiden Beinen fest im Leben – ich bin mir sicher, dass sie das richtige Rüstzeug mitbringt, um ein Jahr in den USA zu leben und davon zu profitieren“, ist sich Nick sicher.
Er freut sich mit Leni, dass ihr Abenteuer hoffentlich im Januar beginnen kann: „Die Organisation, die das PPP begleitet, hat viel Erfahrung und kann gut einschätzen, ob die Persönlichkeit eines jungen Menschen zu dem Programm passt, ob derjenige es schafft, über einen längeren Zeitraum von der Familie getrennt zu sein.“ Letztlich hatte er die „schwierige Aufgabe, aus den Vorschlägen der Organisation den jungen Menschen auszuwählen, der am meisten überzeugt. Und ich muss sagen: Leni hat im Gespräch durch ihre ruhige, aber sehr entschlossene Art gepunktet. Ich finde es beeindruckend, dass sie sich getraut hat, sich zu bewerben.“
CDU-Bundestagsabgeordneter Dr. Andreas Nick besuchte Leni und ihre Familie
Leni ist ein Allroundtalent: Sie spielt seit ihrer Kindheit Gitarre, reitet, war Mitglied der Schulband Boondocks, ist im Herolder Gardetanz aktiv, fährt Snowboard, hilft im Wohnheim der Lebenshilfe in Michelbach, in dem ihre Mutter Susanne tätig ist. Sie war Schulsprecherin und ließ sich an der Einricher Schule zur Streitschlichterin ausbilden.
Andreas Nick freut sich sehr, dass Leni Seelbach sich beworben hat: „Es hat Vorbildcharakter, dass sich eine Zehntklässlerin aus einer Realschule plus hier durchgesetzt hat. Ich hoffe, dass sich dadurch künftig noch mehr Realschüler ermutigt fühlen, sich zu bewerben. Auch für junge Berufstätige gibt es übrigens ein PPP – aber aus diesem Bereich gibt es nur wenige Bewerbungen“, so die Erfahrung des Abgeordneten aus Montabaur. Dass Leni so viele Interessen hat, sei in den USA ein großer Vorteil: „Dann hat sie sofort Anknüpfungspunkte, um Freundschaften zu schließen“, ist sich Nick sicher. Der „Transatlantiker“ Andreas Nick hat selbst als Jugendlicher und junger Erwachsener in den USA gelebt und erzählte der 15-Jährigen gern über seine Erfahrungen aus dieser Zeit.

Mit MdB Dr. Andreas Nick (links) freut sich auch die ganze Familie von Leni: Vater Manfred, die Schwestern Ida und Liska, Bruder Niklas und Mutter Susanne (von links), dass sich der Traum von den USA – hoffentlich – möglichst bald erfüllt.
Leni musste vor ihrer Bewerbung zunächst noch ihre Eltern überzeugen, dass sie als jüngstes von vier Kindern in die große weite Welt aufbricht. „Ich wollte schon mit 13 Jahren gern ins Ausland. Erst waren meine Eltern skeptisch, aber inzwischen freuen sich alle mit mir“, erzählt sie. Ihre gleichaltrigen Freundinnen „finden das alle cool, aber sie sagen auch, dass sie sich das nicht zutrauen würden“. Lenis ältere Schwestern und ihr Bruder stehen wie die Eltern voll hinter ihrem Entschluss und sind jetzt „doch ein bisschen neidisch“ auch wenn es sie selbst bisher nicht für einen so langen Zeitraum ins Ausland gezogen hat.
Leni Seelbach ist gespannt: „Ich freue mich darauf, neue Menschen und eine doch ganz andere Kultur kennenzulernen – bisher kenne ich die USA nur aus dem Fernsehen. Ich schaue mir natürlich Videos von You-Tubern an, die dort ein Jahr verbracht haben und über ihre Erfahrungen berichten und bin gespannt, wie es an der Schule zugeht. Vor allem freue ich mich auf die vielen Freizeitangebote, die es dort gibt!“
Auch ihre Eltern längst überzeugt von der USA-Idee: „Die können wir schicken“, betont ihre Mutter Susanne mittlerweile: „Wir hatten ja Zeit, uns an den Gedanken zu gewöhnen. Das ist eine einmalige Chance für Leni, da dürfen wir nicht im Weg stehen.“ Angst vor Heimweh hat Leni nicht – nur einen wird sie wohl ziemlich vermissen: „Mein Hund Elli wird mir bestimmt ganz schön fehlen!“
Noch ist es aber eben leider nicht soweit: Nach den Sommerferien geht es erstmal wieder in die Schule: Weil der Start ins USA-Jahr sich verzögert, musste Leni sich nach ihrem Schulabschluss kurzfristig wieder an einer Schule anmelden: „Die NAOS in Diez war da zum Glück sehr flexibel und hilfsbereit“, lobt Vater Manfred Seelbach. Leni wird also erstmal deutsche Elftklässlerin und dann hoffentlich im Januar endlich zur glücklichen PPP-Absolventin in den USA.
Auslagerung:
Bundestag vergibt Stipendien für USA-Austauschjahr an Schüler und junge Berufstätige:
Das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) gibt seit 1983 jedes Jahr Schülern und jungen Berufstätigen die Möglichkeit, mit einem Stipendium des Deutschen Bundestages ein Austauschjahr in den USA zu erleben. Zeitgleich sind junge US-Amerikaner zu einem Austauschjahr zu Gast in Deutschland. Das PPP ist ein gemeinsames Programm des Deutschen Bundestages und des US-Congress. Es steht unter der Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten. Die Bewerbungsfrist für das Jahr 2021/22 endet am Freitag, 11. September. Derzeit wird von der planmäßigen Durchführung im Jahr 2021/22 ausgegangen. Wegen der Covid-19-Pandemie sind aber Änderungen im Programmablauf möglich.
Weitere Informationen unter: www.bundestag.de/ppp
Lahnstein
Niemals vergessen: Grüne Lahnstein besuchen die Gedenkstätte Hadamar!

HADAMAR An der Gedenkfahrt am Sonntag, den 07.04, nahmen auch interessierte Bürgerinnen und Bürger teil. Zur Teilnahme an der Fahrt war öffentlich eingeladen worden. Die Idee für den Besuch kam im Zuge der jüngsten Entwicklungen rund um das Erstarken rechten Gedankengutes in der Gesellschaft auf. Ziel war es, allen Opfern der nationalsozialistischen Verbrechen und insbesondere denen der „Euthanasie“ zu gedenken. Zudem sollte die Teilnahme an dem Besuch dazu anregen, sich mit dem nationalsozialistischen Unrecht auseinanderzusetzen.
Die Gedenkstätte Hadamar hat eine besondere Bedeutung als Ort des Gedenkens und der Erinnerung an die Opfer der nationalsozialistischen „Euthanasie“. In den Jahren 1941 bis 1945 wurden hier fast 15.000 Menschen ermordet. Zu den Opfern gehörten psychisch Erkrankte und Menschen mit Behinderung. Die Gedenkstätte hat auch den Zweck, über die damaligen Geschehnisse aufzuklären. Von Januar bis August 1941 wurden im Keller der Anstalt über 10.000 Kinder, Frauen und Männer mit Kohlenmonoxid in einer als Duschraum getarnten Gaskammer ermordet. Der Abbruch der Gasmorde 1941 bedeutete nicht das Ende der NS-„Euthanasie“-Verbrechen. Ab August 1942 wurde das Morden fortgesetzt, diesmal bspw. durch überdosierte Medikamente und Hungerkost. Während dieser Zeit kamen noch einmal 4.500 Menschen ums Leben.
Das grausame Vorgehen dauerte bis zum Kriegsende im März 1945 an. Unter den Opfern der zweiten Mordphase befanden sich Anstaltspatienten und -patientinnen, durch den Bombenkrieg verwundete Menschen, Kinder, Tuberkulosekranke, Zwangsarbeiter sowie psychisch Kranke. Die Taten zeigen das Ausmaß der Grausamkeit, das im Namen der Ideologie des Nationalsozialismus begangen wurde. Die Exkursion beinhaltete neben der Führung auch einen Workshop mit Biografiearbeit.
Die Anwesenden zeigen sich betroffen von dem erfahrungsreichen Tag, aber auch dankbar für die Arbeit der Gedenkstätte. Durch das Engagement haben alle die Möglichkeit, sich ein Bild von den Verbrechen, welche unter dem Vorzeichen der nationalsozialistischen Ideologie geschahen, zu machen und dadurch die Sensibilität für die Wahrung der Menschenwürde und der daraus folgenden Rechte zu stärken. Das Fazit der Gruppe ist, dass nur Erinnerung und Aufklärung sicherstellen können, dass sich solche Verbrechen nie wiederholen und eine entsprechende Ideologie nicht mehr Staatsdoktrin werden kann. „Nie wieder“, wie es in den letzten Monaten häufig heißt, bedeutet daher nicht nur, sich gegen den Anstieg rechtsextremer Ideologien und Rassismus einzusetzen, sondern auch die Aufarbeitung der Vergangenheit zu fördern und die Menschenwürde und die Menschenrechte in der Gesellschaft zu schützen. Die Gedenkstätte Hadamar ist ein Ort, an dem dieser Einsatz gelebt wird und an dem gegen das Vergessen angekämpft wird. Insbesondere wollen die Grünen der Workshopleiterin und Gedenkstättenmitarbeiterin Frau Kabs danken.
Koblenz
Wie sieht das Fortbewegungsmittel für den Schängel der Zukunft aus?

KOBLENZ In Koblenz haben sich Mitglieder der CDU Koblenz und des CDU-Nachwuchses (Junge Union Koblenz) mit der Frage beschäftigt, wie das zukünftige Mobilitätskonzept für Koblenz aussehen könnte. Zu diesem Zweck besuchten sie das Bahnbetriebswerk der Mittelrheinbahn von Trans Regio in Koblenz-Moselweiß. Auf der Agenda stand eine Werksbesichtigung, um sich einen Eindruck von der Arbeit des Verkehrsunternehmens zu verschaffen. Mit dabei waren die Kandidaten für den Stadtrat: Philip Rünz (Chef des CDU-Nachwuchses auf Listenplatz 13), Martina von Berg (Listenplatz 17) und Peter Balmes.
Henrik Behrens, der Geschäftsführer der Mittelrheinbahn, führte die Gruppe durch die Hallen des Bahnbetriebswerks und gab ihnen einen Überblick über den öffentlichen Nahverkehr in der Region. Der Austausch mündete in eine belebte Diskussion über die Zukunft der Mobilität. „Für Koblenz als Oberzentrum ist es essenziell, einen öffentlichen Nahverkehr zu schaffen, der durch attraktive Preise und eine effiziente Infrastruktur besticht“, erklärte Philip Rünz.
Alle Teilnehmer waren sich einig, dass die Digitalisierung der Bushaltestellen durch die Installation von digitalen Anzeigen in den nächsten Jahren weiter vorangetrieben werden muss. Zudem sollen Linien, die eine hohe Nachfrage aufweisen, bedarfsgerecht und zu angemessenen Preisen ausgebaut werden.
Ein besonderes Augenmerk lag auf dem Thema Schienenhaltepunkte. „Wir hoffen, dass der Schienenhaltepunkt im Rauental den Durchgangsverkehr, insbesondere durch Moselweiß, endlich spürbar reduzieren wird und die Anbindung für das Verwaltungszentrum und Koblenz als Wirtschaftsstandort verbessern wird“, ist sich Rünz sicher.
In Ergänzung zu diesen Punkten betonten die Ratskandidaten Balmes, Rünz und von Berg auch die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Mobilitätsstrategie: „Koblenz, seine Bewohner, Berufspendler und viele Familien sind auf das Auto angewiesen. Unser Ziel ist es, Auto, Fahrrad und den öffentlichen Nahverkehr auf Augenhöhe zu bringen, nicht das eine dem anderen gänzlich vorzuziehen!“
Der Besuch lieferte der Truppe einige Einblicke und Anregungen, die in die politische Arbeit der CDU einfließen werden. Das Ziel: Den Nahverkehr in Koblenz so zu gestalten, dass er den Bedürfnissen der Einwohner gerecht wird (Pressemitteilung: Junge Union Koblenz).
Politik
FWG Nastätten stellt Liste für die Stadtratswahlen auf

NASTÄTTEN Bei der Mitgliederversammlung im Nastätter Bürgerhaus konnte Vorsitzender Alexander Bayer erfreulich viele Mitglieder der FWG Nastätten begrüßen. Es haben sich wieder 20 engagierte Nastätter gefunden, die bereit sind, für die nächsten 5 Jahre Ihr Engagement, ihr Wissen und ihre Begeisterung für Nastätten in die Stadtratsarbeit einzubringen. Besonders erfreulich ist, dass sich mit Johanna Mieder, Mark Longhin, Max Herrmann („Hebo“), Simon Schmitt und Fayhat Boga auch wieder jüngere Mitbürger engagieren wollen, und mit Manfred Singhof ein langjähriges FWG-Mitglied wieder für die FWG antritt. Wichtig ist aber auch, dass die „alten“ FWG-ler, die teils Jahrzehnte im Stadtrat und der Fraktion mitgearbeitet haben, sich bereiterklärt haben, auch aus der „zweiten Reihe“ die Arbeit der FWG mit ihrer Erfahrung weiterhin zu unterstützen.
Wie Fraktionssprecher Werner Sorg betonte, ist die Arbeit der FWG in Nastätten absolut unabhängig und frei von jeglichen Parteizwängen – die FWG Nastätten e.V. konzentriert sich als eingetragener Verein (nicht Partei!) seit mittlerweile über 40 Jahren einzig und allein auf die konstruktive Stadtratsarbeit in Nastätten.
Bei der Wahl am 9.6.2024 bitten diese Nastätter um Ihre Stimme:
- Anke Sorg
- Alexander Bayer
- Tobias Behnke
- Henning Reitershan
- Werner Sorg
- Christof Heil
- Ulrich Gasteyer
- Max Herrmann
- Simon Schmitt
- Manfred Singhof
- Johanna Mieder
- Thomas Debus
- Peter Schumacher
- Claus Genius
- Martin Ludwig
- Fayhat Boga
- Mark Longhin
- Daniel Gutal
- Paul-Otto Singhof
- Erich Gugler
-

 Allgemeinvor 2 Jahren
Allgemeinvor 2 JahrenRhein-Lahn-Kreis feiert 1. Mai – Wir waren in Dornholzhausen, Nievern, Hirschberg und Fachbach – Video im Beitrag
-

 VG Loreleyvor 3 Jahren
VG Loreleyvor 3 JahrenVG Loreley bietet Sommerfreizeit für Kinder aus den Flutgebieten
-

 Koblenzvor 2 Jahren
Koblenzvor 2 JahrenKoblenz beschließt neue Baumschutzsatzung
-

 Schulenvor 2 Jahren
Schulenvor 2 JahrenVG Bad Ems-Nassau investiert in die Sanierung der Turnhalle der Freiherr-vom-Stein Schule Bad Ems
-

 Gesundheitvor 1 Jahr
Gesundheitvor 1 JahrPflegekammer RLP muss Beiträge an Mitglieder erstatten!
-

 Gesundheitvor 2 Monaten
Gesundheitvor 2 Monaten190 Mitarbeiter werden ab morgen im Elisabeth-Krankenhaus in Lahnstein entlassen: Hospital wird zur Psychiatrie!
-

 Rhein-Lahn-Kreisvor 1 Jahr
Rhein-Lahn-Kreisvor 1 JahrBeamtinnen auf Lebenszeit ernannt
-

 Lahnsteinvor 1 Jahr
Lahnsteinvor 1 JahrSorge vor Vollsperrung der B42 hält an