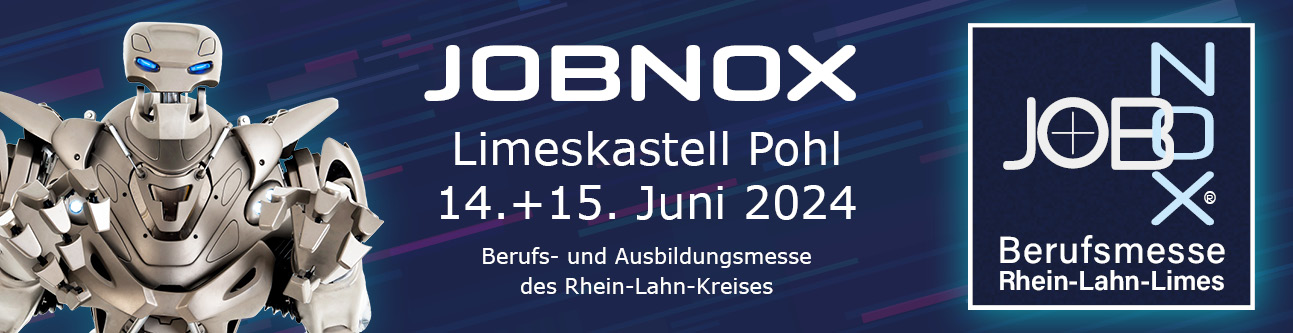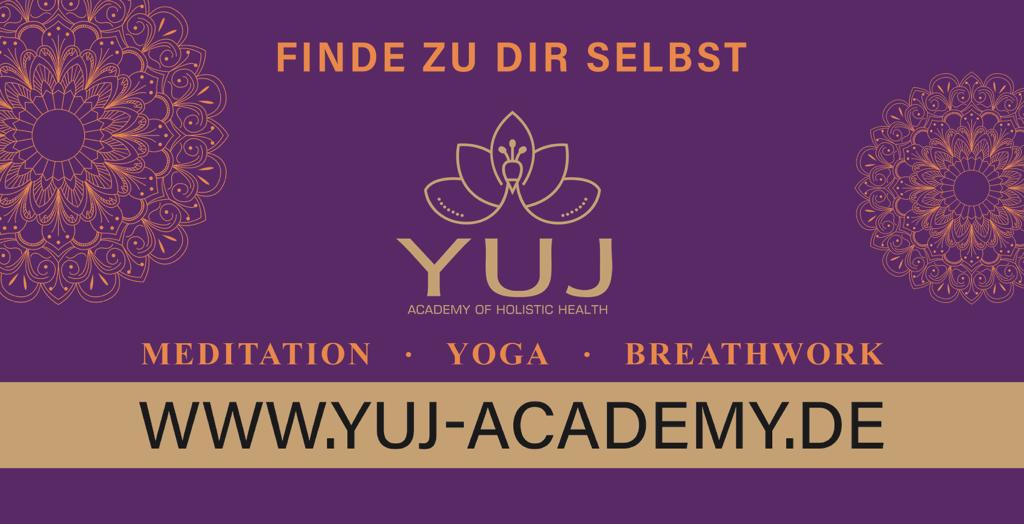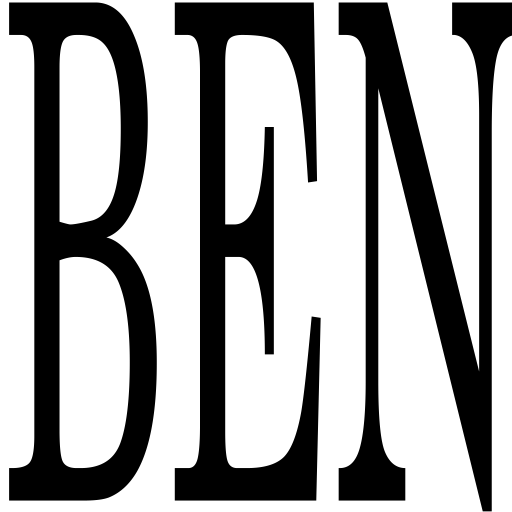Gesundheit
20 Jahre Selbsthilfegruppe Wolkenschieber
BAD EMS Der BEN Kurier führte mit dem Begründer und Leiter der größten Selbsthilfegruppe in Rheinland-Pfalz für psychisch erkrankte Menschen ein Interview. Schnell wurde klar: “Der Bedarf an freien Therapieplätzen ist enorm.”
 Die SHG-Wolkenschieber feiern ihr 20-jähriges Bestehen
Die SHG-Wolkenschieber feiern ihr 20-jähriges Bestehen
BAD EMS Der BEN Kurier führte mit dem Begründer und Leiter der größten Selbsthilfegruppe in Rheinland-Pfalz für psychisch erkrankte Menschen ein Interview. Schnell wurde klar: “Der Bedarf an freien Therapieplätzen ist enorm.” Selbsthilfegruppen leisten erstaunliches. Durch den Erfahrungsaustausch finden Betroffene Halt und können oftmals ihre Lebenssituation stabilisieren. Und dennoch ist die staatliche Lobby für solche Angebote gering.
Hallo Herr Minnemann. Sie können ruhig Jason sagen. Okay. Du hast eine Selbsthilfegruppe für psychisch erkrankte Menschen gegründet. Wie kam es dazu? Ich erfuhr damals, dass ich an Multiple Sklerose leide. Eine niederschmetternde Diagnose die mein Leben erschütterte. Alles was man so plante war Makulatur. Und in solchen Phasen ist es nicht unüblich, dass diese durch Depressionen begleitet werden. So war es auch bei mir. Gerne hätte ich mich mit ebenfalls Betroffenen ausgetauscht aber da gab es keine Selbsthilfegruppen die einem im Erfahrungsaustausch ein wenig Angst hätten nehmen können. Und so kam ich im Oktober 2000 auf die Idee selber eine solche Selbsthilfegruppe zu gründen. Dabei ging es natürlich vorrangig um die psychischen Belange und nicht um die Multiple Sklerose. Ich lernte eine Diplom Sozialpädagogin von der Caritas kennen. Diese griff meine Idee auf und unterstützte mich im Aufbau der Selbsthilfegruppe. Unter anderem stellte sie mir auch Räumlichkeiten zur Verfügung. Im Gemeindeblättchen der Stadt Weißenthurm annoncierte ich das Angebot der neuen Gruppe und schon kamen die ersten Anfragen. Ja. und ab da an startete ich in den Caritas Räumlichkeiten in Weißenthurm.
Ging es Dir damals besser? Ich hatte mich mit der Multiple Sklerose arrangiert. Sie war halt da. Aber. Meine Depressionen waren Geschichte. ich hatte eine neue Aufgabe die mich forderte. Dass diese Berufung einmal mein Beruf werden sollte, konnte ich seinerzeit noch nicht erahnen.
Es war damals bestimmt ein Riesenansturm auf die Selbsthilfegruppe? Oje (*lacht). Überhaupt nicht. Es ging ganz bescheiden los. Gerade einmal fünf Leute meldeten sich. Aber das war egal. Ein Anfang war geschaffen. Wir trafen uns alle 14 Tage in Weißenthurm. Und besonders diese Zeit war für mich sehr wertvoll. Eine Zeit des Lernens.
Eine Zeit zum Lernen? Wie meinst Du das Jason? Na ja. Für mich war alles Neuland. Ich saß dort mit den Leuten in kleiner Runde und sollte diese Gruppe anleiten. Dabei hatte ich keinerlei Erfahrungen mit so etwas. Aber ich war wissbegierig und wurde mutiger. Ich stellte Fragen und hörte zu. Die Menschen erzählten mir und der Gruppe von Ihrem Alltag und ihren psychischen Problemen. Ich konnte viel für mich mitnehmen. Und ich merkte welche Eigendynamik solch eine Gemeinschaft prägt. Es ist wie eine Welle die durch das gemeinsame Gespräch und die Fähigkeit zuzuhören, Lösungen erarbeitet. Es ist eine sehr spannende Erfahrung für mich gewesen.
Und Heute bist Du ein alter Hase? Alt und wieso Hase? (*grinst). Ich nenne es lieber einen erfahrenen Leiter und Mentor. Aber auch ich lerne noch immer dazu.
Zu mindestens hast Du Deinen Humor nicht verloren. Es gibt doch bestimmt nichts zum Lachen in solchen Gruppen. Was für Patienten behandelt Ihr? Zunächst einmal sind das keine Jammergruppen. Natürlich wird trotz der ernsten Thematik gelacht. Und das ist auch verdammt gut so. Und es sind auch keine Patienten sondern Betroffene. Patienten dürfen sie in einer Klinik sein aber nicht in einer Selbsthilfegruppe. Da sind wir alle gleich. Und bei den Diagnosen in den einzelnen Gruppen geht es quer durch die Bank. Von Depressionen über Angststörungen, sozialen Phobien, selbstverletzenden Verhalten, Zwangsstörungen bis hin zu Borderlinern. Auch trockene Alkoholiker oder ehemalige Drogenabhängige holen sich die nötige Stabilität bei den Wolkenschiebern.
Psychisch Kranke haben keine Lobby
Wie kam es zu dem Namen Wolkenschieber? Ich sah mir gerade die Wetternachrichten mit dem Kachelmann an….. Dein ernst? Nein (*lacht). Psychische Erkrankungen sind wie eine Wolkenwand. Und Selbsthilfegruppen können einem durch so manchem Regen helfen oder zeigen wie man darin klar kommt. So manche Male verschwindet der Nebel gänzlich. Darum fand ich das Synonym Wolkenschieber perfekt für eine solche Selbsthilfegruppe.
Ja. Das passt. Es heißt, dass die Wolkenschieber eine der größten Selbsthilfegruppen in Deutschland wären? Das weiß ich nicht. Das kannst Du wahrscheinlich besser beurteilen wie ich. Für Rheinland-Pfalz könnte es zutreffend sein. In Koblenz gibt es in der Bethesda Stiftung aktuell 10 Gruppen, zwei in Weißenthurm und eine ganz neue in der Rhein Mosel Fachklinik. Und natürlich nicht zu vergessen die bald beginnende Gruppe in Bad Ems. Insgesamt dürften es damit etwa 180 betreute Personen sein.
Und wer leitet diese Gruppen? Mentoren moderieren die Gespräche. Sie achten darauf dass die Gruppenregeln eingehalten werden und sind gleichzeitig Ansprechpartner für die Betroffenen.
Sind die Mentoren Psychologen? Nein. Glücklicherweise nicht. Das wäre auch kontraproduktiv. Mentoren sind ehemalige oder teilweise noch immer selbst betroffene Menschen. Dabei sind diese soweit gefestigt, dass sie eine solche Aufgabe übernehmen können. Der Vorteil liegt einfach darin, dass die Mentoren sich viel tiefer in die Situation hineindenken können. Keine bloße Theorie.
Werden in der Selbsthilfe nicht belastende Dinge erzählt? Wie gehen diese Mentoren damit um? Natürlich erfahren die Mentoren, aber auch die ganze Gruppe, belastendes aus dem Leben der Beteiligten. Nur so können Erfahrungen ausgetauscht werden. Viele erkennen sich in der Problematik wieder oder konnten bereits Lösungen erarbeiten die sie wiederum teilen. Die Mentoren werden besonders unterstützt. Diplom Sozialpädagogen und ich halten viermal im Jahr Supervisionen ab. Die Gruppenleiter haben dort die Möglichkeit der Selbstreflexion. Schwierigkeiten in der Gruppe und belastende Ereignisse werden erörtert. Zusätzlich haben wir alle vier Wochen Mentorentreffen. Da tauschen wir uns internen Erfahrungen aus.
Mich würde noch etwas zu den Mentoren interessieren. Wie viele arbeiten für die Wolkenschieber und wie genau leiten diese die Gruppen? Aktuell sind es 13 Mentoren. In einer sogenannten Befindlichkeitsrunde bekommt jeder Betroffene die Möglichkeit das Erlebte der vergangenen 14 Tage darzustellen. Es geht um eine Momentaufnahme. Die Mentoren hinterfragen das Eine oder Andere. Manche benötigen etwas mehr Zeit. Bei introvertierten Betroffenen versucht der Mentor genauer hinzuschauen. Nach dieser Eingangsrunde entwickeln sich häufig von alleine die Themen. Wie erwähnt, leben die Gruppen von der Eigendynamik und dem Erfahrungsaustausch. Es ist für die Mentoren stets eine Gradwanderung jedem genügend Raum und Zeit zu geben.
Selbsthilfegruppen sind Kliniken nicht gleichgestellt.
Kann man einfach bei den Wolkenschieber vorbeikommen? Nein. Das geht leider nicht. Zunächst bedarf es einem telefonischen Vorgespräch. Oder einer E-Mail über unsere Webseite. Ich versuche in so einem Gespräch den Leidensdruck und die Diagnosen zu klären.
Das heißt, dass Teilnehmer vorab eine psychiatrische Diagnose haben müssen? Nicht unbedingt. Mir reicht es aus, den aktuellen Stand zu wissen. Daraus ergeben sich vielfach bereits anzunehmende Diagnosen. Es ist ja so, dass Betroffene oftmals lange Wartezeiten auf eine ambulante psychiatrische Therapie haben. Daran änderte sich bis heute wenig. Auch wenn der Gesetzgeber sagt, dass jeder kurzfristig Anspruch auf eine ärztliche Versorgung hat, so ist das in der Realität völlig anders. Wartezeiten von bis zu einem Jahr oder mehr sind keine Seltenheit. Selbst die kassenärztliche Vereinigung kommt an ihre Grenzen. Der Idealfall wäre es, wenn diese einen Therapeuten mit freien Kapazitäten vermitteln. Doch die Wahrheit ist ernüchternd. In der Regel bekommen die Betroffenen eine Liste zugesendet, auf der sämtliche Psychotherapeuten im Umkreis verzeichnet sind. Und genau diese haben meist keine freien Therapieplätze da sie von allen abgearbeitet wurden. Häufig ist nur ein Anrufbeantworter erreichbar. Nicht selten mit dem Text, dass im selben Jahr keine Patienten mehr aufgenommen werden. Und sollte ein Betroffener doch einmal Glück haben, sind die Entfernungen zu den Psychotherapeuten enorm. Einfache Fahrtstrecken von 60 Kilometer und mehr sind keine Seltenheit. Dieses hält der Gesetzgeber für zumutbar. In der Praxis kaum haltbar. Denn es setzt voraus, dass jeder Hilfesuchende mobil ist.
Und was ist mit den Kliniken im Umkreis? Diese stellen Angebote. Im Bereich Koblenz ist es in erster Linie die Rhein-Mosel Fachklinik und für den Rhein – Lahn – Kreis das Elisabeth Krankenhaus in Lahnstein. Aber….. Auch dort gibt es Wartezeiten. Nicht jeder Erkrankte möchte stationär behandelt werden. Und selbst wenn, dann muss er mit guten sechs bis acht Wochen Wartezeiten rechnen. Oftmals sogar deutlich länger. Und bei den Tageskliniken sieht es ähnlich aus. Letztlich gibt es noch die psychiatrischen Institutsambulanzen. Diese sind für Patienten da, die aktuell dringenden Bedarf haben aber keinen Therapeuten finden. Doch so viel besser sieht es bei denen auch nicht aus. Auch dort muss mit Wartezeiten gerechnet werden. Letztlich bleiben nur noch die Akutstationen. Doch wer nicht gerade suizidal gefährdet ist oder zum Beispiel einen psychotischen Schub hat, steht vor verschlossener Tür. Aus meiner Sicht ist dieses ein großes Dilemma im Gesundheitssystem. Es fehlen zahlreiche ambulante Therapieplätze.
Gibt es einen Grund dafür? Ja. Den gibt es. Psychiatrische Erkrankungen sind im Verlaufe der vergangenen zwanzig Jahre massiv gestiegen. Wir sind in einer schnelllebigen Zeit. Hoher Leistungsdruck. Wir müssen in der Gesellschaft funktionieren. Das Ergebnis sind Burnout, Depressionen und so weiter. Die Seele leidet und ist zur Volkskrankheit Nummer eins geworden. Jedoch die Zahl der zugelassenen Therapeuten blieb lange Zeit konstant. Der Bedarf konnte nicht mehr gedeckt werden. Zwar wird der Bereich heute massiv ausgebaut aber die Maßnahmen kommen spät. Wenn nicht sogar zu spät.
Und wie sieht das bei Euch aus mit Wartezeiten? Tja….. 2019 war eine Katastrophe. Es gab einen kompletten Aufnahmestop. Für mich war das eine belastende Zeit. Menschen mit akuter Problematik abweisen zu müssen da die Gruppen voll waren. Die Situation hat sich etwas entspannt. Und dennoch gibt es Anwartschaften zwischen drei bis sechs Monaten. Ich sehe aber Licht am Horizont. Wir öffnen gerade neue Gruppen. Wie zum für den Rhein-Lahn-Kreis in Bad Ems. Da sind sogar noch ein paar wenige Plätze frei.
Müssen die Betroffenen in den Gruppen etwas über sich erzählen? Eine Selbsthilfegruppe lebt vom Erfahrungsaustausch. Und jeder möchte davon profitieren. Sich selber reflektieren. Doch jeder Mensch ist anders. Zu Beginn starten die neuen Wolkenschieber meistens in der Auffanggruppe. Dort haben sie die Möglichkeit den Ablauf in einer Selbsthilfegruppe kennenzulernen. So einige sind eher introvertiert und hören zu. Auch das wird akzeptiert. In der Regel ist es so, dass jeder irgendwann einmal etwas über sich erzählt. Was er sagen mag, bleibt demjenigen überlassen.
Wie setzen sich die Gruppen zusammen? Wie eben erwähnt, starten wir in den Auffanggruppen. Dort versuchen wir nach etwa fünf Teilnahmen für die jeweiligen Betroffenen die passenden und dauerhaften Gruppen zu finden. Dieses hat durchweg weniger etwas mit dem Krankheitsbild zu tun wie mit der harmonischen Gruppenbild. Es muss für alle Beteiligten passen. Darauf achten wir. Es gibt auch zwei Gruppen für Psychiatrie erfahrene Patienten. Wegen dem hohen Bedarf finden diese wöchentlich statt. Neulinge, mit einem aktuellen Burnout oder einer Depression, wären in solchen Gruppen vielleicht überfordert. Andererseits könnten sie auch von dem Erfahrungsschatz profitieren. Das ist stets eine Gradwanderung für die Mentoren welche die neuen Wolkenschieber einschätzen.
Also sind die Gruppen nicht nach Krankheitsbild gegliedert? Richtig. Das hat sich bewährt.
Wie sieht es denn mit der Schweigepflicht aus? Ein wichtiger Aspekt. Jeder Betroffene unterliegt der Schweigepflicht. Es werden ja teilweise sehr private Sachen in den jeweiligen Gruppen erzählt. Und somit muss jeder Teilnehmer auch eine Schweigepflichtserklärung unterschreiben. Würde ein Teilnehmer gegen dieses Gebot verstoßen, wäre er raus. Und Weiterungen sind nicht ausgeschlossen. Da gäbe es meinerseits keine Toleranz. ich muss aber sagen, dass das bisher hervorragend funktionierte.
Wie oft treffen sich die Wolkenschieber? Alle 14 Tage und zwei Stunden. Das ist in sämtlichen Gruppen gleich.

Die SHG-Wolkenschieber feiern ihr 20-jähriges Bestehen
Wie ist das Verhältnis zwischen den Wolkenschiebern? Das ist eine spannende Sache. Innerhalb der Gruppen entwickeln sich häufig Freundschaften. Die Schnittpunkte des Lebens verbinden. Manche denken, dass sie alleine auf der Welt anders sind. Dabei kann anders richtig gut sein. Und sie sehen, dass es da noch einige mehr gibt die vor den gleichen Schwierigkeiten stehen wie sie selber. Zusätzlich gibt es auch alle vier Wochen einen Wolkenschieber Stammtisch in wechselnden Pubs oder Restaurants. Somit kommt auch der übergreifende Kontakt außerhalb der Gruppen Zustande. Natürlich sind die Teilnahmen freiwillig wie so alles bei den Wolkenschiebern.
Das heißt, Du bekommst kein Geld von den Betroffenen? Wie finanzieren sich die Wolkenschieber? Ja. Das stimmt. Die Teilnahme kostet nichts. Die Wolkenschieber finanzieren sich durch Fördergelder der AOK. Die Bethesda Stiftung stellt Räumlichkeiten zur Verfügung. Genauso wie die Rhein-Mosel-Fachklinik und der VfL Bad Ems. Ohne die Unterstützungen für Raummieten, Fixkosten, Büro und Supervisionen, würde es nicht funktionieren.
Leitest Du noch selber eine Gruppe? Bis 2018 betreute ich Gruppen in Andernach. 18 Jahre sind eine sehr lange Zeit und auch ausreichend. Im Notfall springe ich ein. Doch bei den Wolkenschiebern kümmere ich ich um administrative Aufgaben.
Und was machst Du beruflich? Ich habe meine Berufung zum Beruf gemacht. Nach dem Studium zum psychologischen Berater, biete ich intensive Einzelgespräche oder auch Paarberatungen in Krisen an.
Aktuell gibt es immer noch die Corona Einschränkungen. Wie seid ihr damit umgegangen? Schwierig. Zu Beginn des Lock Down mussten wir uns etwas einfallen lassen. Wochenlang waren sämtliche Treffen nicht möglich. Besonders Für die Betroffenen eine Katastrophe. Für viele waren die 14-tägigen Treffen die einzigen Kontakte zur Aussenwelt. Für Teilnehmer mit sozialen Phobien ein unhaltbarer Zustand. Und da zeigte sich wieder wie toll unsere Mentoren sind. In den Watsappgruppen oder über Videokonferenzen wurden Sitzungen abgehalten. Das war natürlich nicht mit den realen Treffen vergleichbar. Mittlerweile entspannte sich die Situation. In einigen Städten finden wieder regelmäßige Treffen statt. Andere Standorte sind noch immer geschlossen. Und besonders in dieser schwierigen Zeit mussten wir erkennen, wie klein die Lobby für Selbsthilfegruppen ist.

In Krisen gemeinsam statt einsam Lösungen erarbeiten – das sind die Wolkenschieber
Wie meinst Du das? Tanzschulen, Fitnessstudios und auch Tageskliniken in den Krankenhäusern wurden geöffnet. Dort stehen vorrangig finanzielle Interessen. Doch Selbsthilfegruppen wurden vom Staat in der Coronakrise überhaupt nicht beachtet. Es gab keinerlei Programme. Selbsthilfegruppen sind Kliniken nicht gleichgestellt. Und es zeigt auch, dass Menschen mit Depressionen etc. keine Lobby haben. Dabei wäre es durchaus möglich gewesen, unter Beachtung der Corona Schutzmaßnahmen, die Gruppenabende abzuhalten. Einerseits schätzen Kliniken und Ärzte die stabilisierende Wirkung von Selbsthilfegruppen. Wartezeiten zu stationären oder ambulanten Therapien werden überbrückt. Andererseits wird das Angebot als Selbstverständlichkeit betrachtet anstatt eigene medizinische Plätze auszubauen. Und gerade in der Coronakrise erlebten wir für die Betroffenen große Rückschläge. Therapien wurde unterbrochen. Die Menschen wurden erneut instabil. Kleine Schritte sind für psychisch erkrankte Menschen oft Siebenmeilenstiefel. Und diese Wege zu gehen ist oft eine schmerzhafte Erfahrung. Und all jenes müssen sie jetzt erneut durchleben.
In Krisen gemeinsam statt einsam
Wie war es für Dich während der Coronazeit? Anders wie erwartet. Auch ich konnte keine Vor-Ort Sitzungen mehr anbieten. Kurzerhand entschloss ich mich die Gespräche per Videokonferenz abzuhalten. Und das Angebot wurde intensiv genutzt. Für mich gab es keine Einbußen. Im Gegenteil. Eine Win-Win Situation für die Betroffenen und mich.
Dieses Jahr wären die Wolkenschieber 20 Jahre alt geworden……? Ja. Ich sehe das mit einem lachenden und weinenden Auge. Die Freude über das Erlebte und den großen Rückhalt ist enorm. Doch der Wermutstropfen ist da. Wir wollten dieses besondere Jubiläum mit den Bürgermeistern, Förderverein und sämtlichen Wolkenschieber groß feiern. Doch Corona hat uns da einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. Bekanntlich ist verschoben nicht aufgehoben. Wir werden einen neuen Termin finden.
Lieber Jason. Der BEN Kurier dankt Dir für dieses tolle Interview und wünscht Dir weiter viel Erfolg bei deiner so wichtigen Tätigkeit.
Wer Hilfe zur Selbsthilfe sucht, ist bei den Wolkenschiebern gut aufgehoben. Unter dem Motto “Aktives Leben lernen,” finden die regelmäßigen Treffen der SHG-Wolkenschieber in Weißenthurm, Andernach, Koblenz und demnächst Bad Ems statt. Erkundigen können Sie sich über die webseite www.shg-wolkenschieber.de Dort finden Sie auch ein Kontaktformular.
Vorgespräche führt Herr Minnemann unter der Telefonnummer 0177-616 6615
Gesundheit
Glückwunsch: Plastische Chirurgie in Bad Emser Paracelsus-Klinik eröffnet

BAD EMS Für Dr. Donya Heinrich ein großer Schritt. Von der plastischen Chirurgie in Lahnstein wagte sie nun den Schritt in die Selbständigkeit und eröffnete ihre eigene Praxis im Gebäude der Paracelsus-Klinik in Bad Ems und das könnte ein erstes kleines Signal für die Wiederbelebung des Standortes in der Kurstadt sein. Neben dem Zahnarzt Dr. Blum und dem Kardiologen Dr. Reisinger füllen sich jetzt die Räumlichkeiten mit der ästhetischen Chirurgie.
 Anzeige
Anzeige Wer an plastische Behandlungen denkt, vermutet dahinter zunächst Verschönerungen für Menschen mit großen Geldbeutel, doch das ist falsch. Auch Kassenpatienten sind häufige Patienten oder Gäste in den neu gestalten Räumen in der Paracelsus-Klinik. Mal geht es um die Behandlung eines Muttermals, abstehenden Ohren, Handschmerzen oder auch um die Entfernung von Hautkrebs. Alles Leistungen, die von Dr. Donya Heinrich erbracht werden. Dabei endet auch die plastische Chirurgie nicht beim Fettabsaugen oder der Brustvergrößerung.

Dazu zählen auch chirurgische Behandlungen nach Unfällen vom Gesicht, über die Hände bis hin zu den Füßen. Und wer dann doch den Körper schönheitschirurgisch behandeln lassen möchte, der darf sich natürlich auch an die klassischen Falten heranwagen. Nicht immer muss es direkt ein Facelift sein. Hyaloron- oder Botoxspritzen gehören zum Alltag der klassischen ästhetischen Verfahren. Kleinere chirurgische Eingriffe werden ambulant in zwei modernen Operationssälen in den Räumlichkeiten der Praxis durchgeführt. Größere Operationen führt Dr. Donya Heinrich im Paulinenstift in Nastätten durch.
Dabei wurde eines am Ende recht deutlich: Bad Ems ist nicht Düsseldorf und die Preise der Schönheitschirurgie sind durchaus preiswert und heute nicht mehr nur ein Luxusvergnügen. Ein reines Frauenvergnügen, mit dem sich die Männer dann schmücken dürfen? Schon lange nicht mehr. Auch die Herren der Schöpfung haben längst erkannt, dass sie ihren potenziellen Marktwert durch kleine Eingriffe steigern können und das Altern nicht nur die Damen betrifft.
Der Bad Emser Stadtbürgermeister Oliver Krügel gratulierte Dr. Donya Heinrich zur Eröffnung der plastischen Chirurgie
Und wenn es einmal soweit ist, sollte man sich in die Hände von erfahrenen Ärzten begeben. Dr. Donya Heinrich studierte von 2002 Medizin an der Universität in Heidelberg und erlangte dort ihren Doktorgrad. 2010 bildete sie sich weiter in der Allgemein- und Viszeralchirurgie bevor es zur Unfallchirurgie und Notfallmedizin ging. 2013 wechselte die Ärztin in die Koblenzer Klinik für Plastische- und Handchirurgie. Dort erlangte sie auch den Facharzttitel der Platischen- und Handchirurgie bevor sie von 2017 an die Sektion Plastische- und Handchirurgie am St. Elisabeth-Krankenhaus in Lahnstein leitete und Koblenz aesthetics gründete.
Nebenbei erhielt sie nach Prüfung in Brüssel die europäische Zusatzqualifikation zur europäischen Fachärztin für plastische Chirurgie. Nebenbei arbeitete sie bei Auslandseinsätzen in verschiedenen Kliniken und engagiert sich noch heute im humanitären Bereich bei Humanity First in Benin in Westafrika. Ein beeindruckender Lebenslauf der verheirateten Mutter von zwei Töchtern. Dank der Lahnsteinerin wird der Gesundheitsstandort Bad Ems wieder gestärkt. Termin kann man direkt über die Webseite https://www.plastische-aesthetische-chirurgie-bad-ems.de vereinbaren oder telefonisch unter 02603-9683900.
Gesundheit
Hallo Henry: Neuer Krankentransportwagen für das DRK Diez

DIEZ Der Rhein-Lahn-Kreis sowie der DRK Ortsverein Diez haben gemeinsam einen Krankentransportwagen beschafft. Am Sonntag wurde dieser gemeinsam vom Rhein-Lahn-Kreis sowie dem DRK Ortsverein Diez beschaffte Krankentransportwagen (KTW) offiziell in Dienst gestellt. Eingeladen waren zu dieser Veranstaltung u. a. Vertreter aus dem Land- und Kreistag, sowie kommunale politische Vertreter (Bürgermeisterin der VG Diez und Bürgermeisterin der Stadt Diez). Anwesend waren auch zahlreiche Mitglieder des DRK Ortsvereins Diez und Katzenelnbogen, Leitende Notärzte, Organisatorische Leiter und SEG Zugführer sowie viele Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehr Diez-Freiendiez und auch Vertreter von Katastrophenschutzeinheiten des Kreises.

Die Einsegnung beider Fahrzeuge erfolgte durch Karin Stump (Kath. Pfarrei St. Christopherus) und Kerstin Lüderitz (Ev. Jakobusgemeinde), die sich dankenswerterweise bereit erklärten, dies zu übernehmen. Das Fahrzeug wird dem DRK Ortsverein für Einsätze und Übungen der Schnelleinsatzgruppe des Rhein-Lahn-Kreises, sowie auch dem Katastrophenschutz zur Verfügung gestellt.
Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich mit 40 % und der Rhein-Lahn-Kreis als kommunaler Aufgabenträger mit 25 % der förderungsfähigen Kosten. Der DRK Ortsverein übernimmt die restlichen Kosten.
Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens erhielt die Fa. Elbe den Zuschlag. Auch hier war ein Vertreter vor Ort. Landrat Jörg Denninghoff bedankte sich bei dem DRK Ortsverein Diez, insbesondere bei dem Zweiten Vorsitzenden Frank Fachinger sowie bei dem Stellv. Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Marcus Grün für die äußerst konstruktive und zeitintensive Zusammenarbeit bei der Beschaffung dieses Fahrzeugs. Auch sei dem DRK Ortsverein Diez für die hervorragende Organisation dieser Veranstaltung gedankt.
Auch der 1. Vorsitzende des DRK OV Diez, Michael Schnatz, begrüßte die Umsetzung der Beschaffung dieses neuen Einsatzfahrzeuges (Text: Rhein-Lahn-Kreis).
Gesundheit
Unklare Lage am Paulinenstift: Viele offene Fragen und noch mehr Gerüchte

NASTÄTTEN Immer wieder wird derzeit über den Fortbestand des Krankenhauses Paulinenstift in Nastätten gesprochen. Dabei sind viele Fragen offen und leider auch noch mehr Gerüchte im Umlauf. Fakt ist: Die gGmbH Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM), zu dem das Krankenhaus in Nastätten gehört, hat den Versorgungsauftrag vom Land und steht damit in der Verantwortung. Dazu gehören alle 5 Standorte (Mayen, Koblenz Kemperhof, Koblenz Ev. Stift, Boppard und Nastätten). Die Positionierung des Gesundheitsministers ist eindeutig: Nastätten ist bedarfsnotwendig und kann nicht separat rausgelöst werden.
Diskussion um das Paulinenstift in Nastätten: SPD fordert Klarheit in der weiteren Debatte
Mit Aufkommen der Diskussion hat Landrat Jörg Denninghoff gemeinsam mit seinem Kollegen Volker Boch (Landrat Rhein-Hunsrück-Kreis) schriftlich um Informationen bei den aktuellen Trägern des GKM gebeten. Wie Denninghoff auf Nachfrage der SPD-Kreistagsfraktion dieser mitteilte, gibt es bislang noch keine Reaktion auf die Anfrage. Bemerkenswert ist, dass es bisweilen auch trotz Nachfrage immer noch keine Reaktion gegenüber den beiden Kreisen gab.
„Wir bedauern das sehr. Gerne würden wir in den Kreisgremien über das weitere Vorgehen auf der Grundlage von Daten und Fakten beraten“, so Kreistagsmitglied und Stadtbürgermeister Marco Ludwig. „Wir wollen einen offenen und konstruktiven Dialog und stehen klar zum Erhalt des Standorts in Nastätten. Das ist für uns erklärtes Ziel“, ergänzt Fraktionsvorsitzender Carsten Göller.
-

 Allgemeinvor 2 Jahren
Allgemeinvor 2 JahrenRhein-Lahn-Kreis feiert 1. Mai – Wir waren in Dornholzhausen, Nievern, Hirschberg und Fachbach – Video im Beitrag
-

 VG Loreleyvor 3 Jahren
VG Loreleyvor 3 JahrenVG Loreley bietet Sommerfreizeit für Kinder aus den Flutgebieten
-

 Koblenzvor 2 Jahren
Koblenzvor 2 JahrenKoblenz beschließt neue Baumschutzsatzung
-

 Schulenvor 2 Jahren
Schulenvor 2 JahrenVG Bad Ems-Nassau investiert in die Sanierung der Turnhalle der Freiherr-vom-Stein Schule Bad Ems
-

 Gesundheitvor 1 Jahr
Gesundheitvor 1 JahrPflegekammer RLP muss Beiträge an Mitglieder erstatten!
-

 Gesundheitvor 2 Monaten
Gesundheitvor 2 Monaten190 Mitarbeiter werden ab morgen im Elisabeth-Krankenhaus in Lahnstein entlassen: Hospital wird zur Psychiatrie!
-

 Rhein-Lahn-Kreisvor 1 Jahr
Rhein-Lahn-Kreisvor 1 JahrBeamtinnen auf Lebenszeit ernannt
-

 Lahnsteinvor 1 Jahr
Lahnsteinvor 1 JahrSorge vor Vollsperrung der B42 hält an